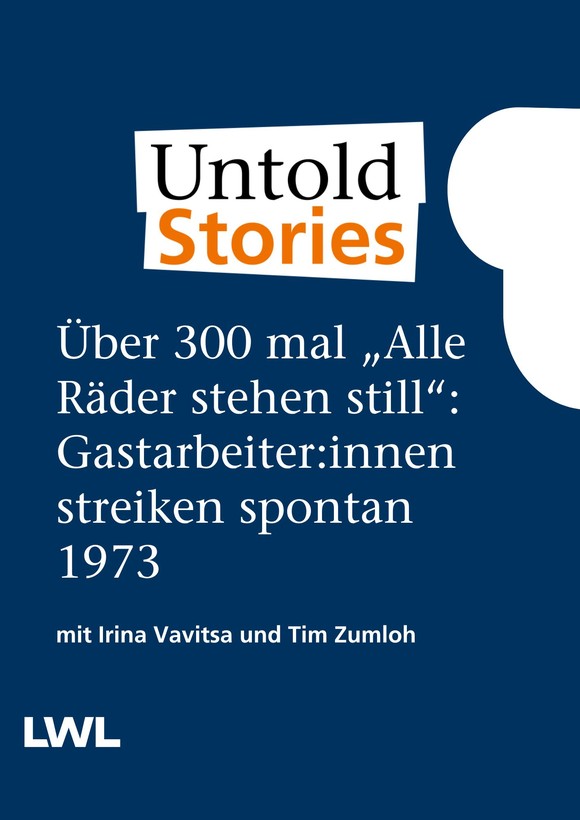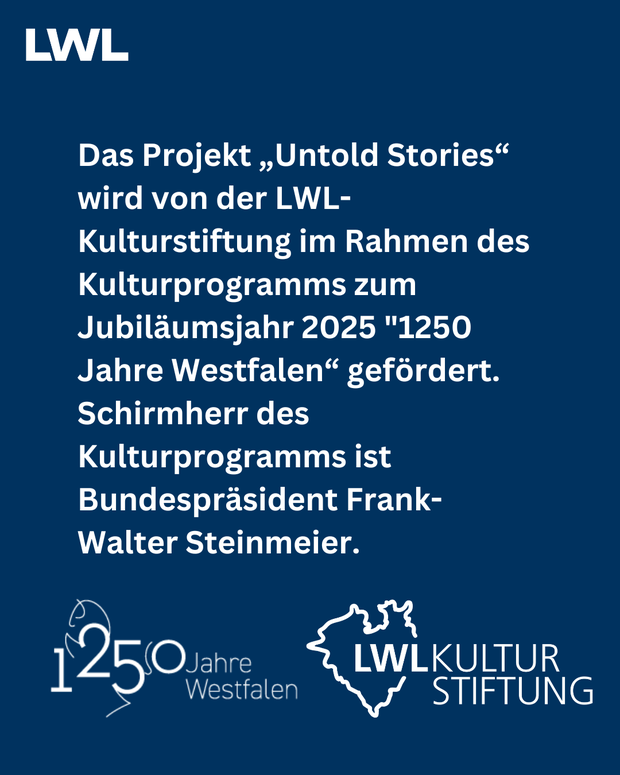Regionalgeschichte auf die Ohren
Greta Civis: Wir riefen Arbeitskräfte und es kamen Menschen. Das wusste Max Frisch schon 1965. Zehn Jahre zuvor, im Dezember 1955, schloss die Bundesrepublik Deutschland das erste Anwerbeabkommen mit Italien. Seitdem wurde im sogenannten „Wirtschaftswunder“ mehrsprachig produziert. 14 Millionen Industriearbeiterinnen und Arbeiter kamen bis 1973 aus Italien, Spanien, Griechenland, der Türkei, Marokko, Portugal, Tunesien und Jugoslawien. Die meisten vorübergehend, einige blieben.
Dann, 1973, zwischen Smockalarm und Ölpreiskrise, passierte es. Überall in Westdeutschland legten sogenannte Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter die Arbeit nieder. In der BRD wurden Firmen besetzt, Verhandlungen geführt, es wurde demonstriert. Die Öffentlichkeit, die Presse und selbst die Gewerkschaften und Betriebsräte sind überrascht und uneins. Solidarität und Unverständnis wechseln sich ab, bis hin zu verbalen und körperlichen Angriffen auf die Streikenden. Doch worum ging es den Streikenden? Was führte zu den Streiks? Wie war das in Westfalen und Lippe? Und wie kam es zu mehr als 300 Streiks von Baden-Württemberg bis Niedersachsen ohne übergreifende Organisation? Das bespreche ich mit
Irina Vavitsa: Irina Vavitsa
Greta Civis: und
Tim Zumloh: Tim Zumloh.
Greta Civis: Ich bin Greta Civis.
Über 300 Mal, alle Räder stehen still. Gastarbeiterinnen streiken spontan, 1973.
Irina ist Zeitzeugin, hat in Lippstadt bei Hella mitgestreikt und war dann Gewerkschafterin und auch Betriebsrätin. Tim ist ein Kollege vom LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte und hat mir das Thema vorgeschlagen. Vielen Dank euch beiden, dass ihr da seid. Bei der Vorbereitung hatte ich außerdem viel Hilfe durch Nihat Öztürk, ehemaliger Geschäftsführer der IG Metall Düsseldorf, sowie Irina Vavitsa, auch ein Name, um den man nicht rumkommt, wenn man zu den Arbeitsniederlegungen 1973 recherchiert. Seine Teilnahme hat leider nicht funktioniert. Er hat mir aber Sprachnachrichten geschickt mit einer Einordnung, die ich gerne als Einstieg ins Thema nutzen würde.
Wir erzählen hier unbekannte Geschichten. Einigen sind sie sehr gut bekannt, denen, die dabei waren, und denen, die sich mit dem Thema beschäftigen, anderen sehr wenig. Und die bekanntesten dieser 300 Streiks, zwei, über die immer wieder geredet wird, sind Ford in Köln und Pierburg in Neuss. Das sind so die ikonischen Streiks. Dazu und zur Rolle der Gewerkschaften, zum Verhalten der Gewerkschaften einmal Nihat Öztürk:
Nihat Öztürk: Die Gewerkschaften standen der Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte sehr skeptisch und teils auch klar ablehnend gegenüber. Positiv hervorzuheben ist aber, dass die Gewerkschaften auf die arbeits-, sozial- und tarifrechtliche Gleichstellung der Arbeitsmigranten bestanden haben. Und sie haben diese Gleichstellung mit durchgesetzt. Das war wichtig, um die deutschen Arbeitnehmer vor Lohndumping und die migrantischen Arbeiter vor Ausbeutung zu schützen. Die markantesten spontanen Streiks der Migrantinnen und Migranten im Sommer 1973 waren der Streik bei Heller in Lippstadt, bei Pierburg in Neuss und bei Ford in Köln.
Der Streik bei Heller wurde von der IG Metall und vom Betriebsrat für gerechtfertigt befunden und moralisch unterstützt. Die Metall-Zeitung berichtete damals sogar mit Bewunderung über den Kampfgeist der streikenden Kolleginnen bei Heller. Bei Ford hingegen stellte sich die Betriebsratsmehrheit entschieden gegen die streikenden Arbeiter. Der Betriebsratsvorsitzende behauptete, dass die angereisten Linksextremisten den Streik organisiert und die unwissenden, unerfahrenen türkischen Arbeiter ausgenutzt haben. Die konservative Presse sprach von Türken-Terror und hetzte gegen die streikenden Arbeiter. Ebenso problematisch war die einseitige Parteinahme des IG Metall Vorstandes für den Fortbetriebsrat. Ganz anders, sogar historisch einzigartig, war die Solidarität mit den streikenden Frauen bei Pierburg im Neuss. Die ganze Belegschaft, alle Betriebsräte, alle Gliederungen der IG Metall und auch die Nachbarschaft, dutzende Betriebsdelegtion aus ganz Nordrhein-Westfalen, Vertreter der Kirchen und Jungsozialisten, feine Damen aus dem Bürgertum und sogar Kommunisten standen solidarisch an der Seite der Streikenden. Kurzum, die Skala reicht von Verweigerung jeglicher Solidarität, ja sogar Bekämpfung der Streikenden, bis hin zu einer historisch beispielhaften Solidarisierung.
Greta Civis: Gehen wir mal 1973 nach Lippstadt, gehen wir nach Heller. Irina, du warst dabei, du warst aktive Streikende. Magst du mal erzählen, wie das war?
Irina Vavitsa: Ja, kurz zu meiner Biografie. Ich bin Griechin, aber ich bin geboren und auch gewachsen in der ehemaligen Sowjetunion, weil meine Eltern waren politische Immigranten in der ehemaligen Sowjetunion. Die waren Widerstandskämpfer im Bürgerkrieg in Griechenland und sonst sind die im Exil gelandet, in der ehemaligen Sowjetunion. Wir kamen 1966 nach Griechenland, weil damals gab es Amnestie für alle politischen Immigranten und so sind wir in Griechenland gelandet, aber ohne Rechte, ohne Papiere, ohne Staatsangehörigkeit. Wir lebten in Griechenland ohne Papier vier Jahre lang, dann kam die Militärdiktatur. Aber ich hatte Glück gehabt, ich habe an Griechen geheiratet. So habe ich auch Papier gekriegt, bin in Griechin geworden. Und 1971 sind wir nach Deutschland gekommen.
Haben wir ein bisschen Glück gehabt, weil da gab es dieses Anwerbeabkommen zwischen Griechenland und Deutschland. So ist mein Mann gekommen zuerst, sechs Monate später kam ich nach Deutschland. Und mein großes Wunder war erstmal, mein Mann musste das bewilligen, damit ich arbeiten dürfte. Und dann habe ich gedacht, in der ehemaligen Sowjetunion, die Frau war im Kosmos und ich 1971 muss meinem Mann erstmal „Ja“ sagen, damit ich arbeiten dürfte, auf meine eigenen Beine zu stehen. Das war meine erste Überraschung.
Naja, ich bin bei Hella gelandet, weil mein Mann war da. Ich sollte auch nur dahin gehen, wo mein Mann gewesen ist. Ja, dann gab es ab und zu so schon Gerüchte, wir werden nicht alle gleich bezahlt. Und weil damals saßen wir alle zusammen, keine Sozialräume gewesen bei Hella. Wir saßen am Band, da wo wir gearbeitet haben. Da haben wir unsere Lohntüten gekriegt und dann haben wir gesehen, die Unterschiede. Wir waren vier in einer großen Personengruppe. Spanier, Italiener, Jugoslawien und Griechen. Du konntest bei Hella alle vier Sprachen lernen, aber kein Deutsch. Wir sprechen immer noch, sage ich jetzt, Hella-Deutsch. Immer noch nach 50 oder über 50 Jahren.
Ja, wir haben die Abrechnungen gesehen, aber wir konnten die nicht lesen. Wir konnten nicht definieren, was draufstand. Aber wir wussten ganz genau wie viele Stunden haben wir gearbeitet und am Ende was ist übriggeblieben? Und da haben wir die Unterschiede gesehen zwischen deutschen Kollegen und ausländischen Kollegen. Damals waren wir Ausländer, jetzt wird neu verpackt, Menschen mit Migrationsgeschichte oder Migranten. Ja, wir haben die Unterschiede gesehen zwischen Männern und Frauen für die gleiche Arbeit, weil wir kannten uns auch, wir haben auch das gleiche Band, wir haben die gleiche Arbeit getan, aber der Lohnunterschied war schon da.
Und es gab immer wieder so ein bisschen Wut im Bauch. Dann haben wir versucht, bei unseren Dolmetschern zu beschweren oder zu fragen, warum sind diese Unterschiede und was haben wir von unseren Dolmetschern gekriegt. Wir sollten froh sein, wir dürfen da arbeiten. Ja, und dann zufällig war ich in einer kleinen Raucherecke, das war keine Sozialräume, das war so eine kleine Rauchecke mit ein paar Automatengetränken. Da wollte ich Getränke holen für meinen Kollegen, da waren einige Kollegen von uns ziemlich laut.
Ja, dann habe ich mitgekriegt, also an dem Tag, der Betriebsrat hat beschlossen, freiwillige Zulagen nur für die deutschen Facharbeiter und wir waren ausgegrenzt. Also für uns war nichts.
Greta Civis: Kurz zum Kontext. 1973 zeichnete sich die Ölpreiskrise ab, die eine allgemeine Teuerung zur Folge hatte. Also die Preise stiegen rapide und das haben Firmen in der Bundesrepublik zum Anlass genommen, Sonderzahlungen auszuschütten, aber eben nicht an alle.
Irina Vavitsa: Also der Betriebsrat hat beschlossen an dem Tag in der Betriebsratssitzung freiwillige Zulage für deutsche Facharbeiter. Im Betriebsrat war aber nur ein italienischer Kollege von 33. Weil wir dürfen damals nicht als Betriebsräte auftreten, weil Italien war ein EU-Land und die Italiener haben mehrere Rechte im Betrieb als wir, als Jugoslawien, Spanien und Griechen. Obwohl der Kollege das mitgekriegt hat und dann bekannt gegeben.
Also vier Leute aus vier Personengruppen laut gesprochen und haben gesagt, ja, wir dulden das nicht, wir lassen das nicht uns gefallen, wir werden auf die Straße gehen. Also die haben gesagt, Irina, du kannst deine Kollegen holen. Dann bin ich losgegangen, dann habe ich Leuten Bescheid gesagt, wir sollen uns alle treffen in einem kleinen Pausenraum. Und so sind wir alle dort gelandet. Auf jeden Fall, wir haben uns verstanden, mit Händen und mit Füßen. Und wir haben gesagt, so, vier Leute, wir waren froh auch, da waren vor uns einige, die konnten schon ein bisschen Deutsch. Die haben gesagt, ja, ihr seid unser Verhandlungskomitee. Die sollten auch zum Arbeitgeber losgehen und verhandeln. Also wie könnten die uns ausgrenzen?
Das große Problem war, unsere Dolmetscher, die haben uns nicht über die gewerkschaftlichen Strukturen erklärt, über Betriebsrat nicht erklärt. Wir haben gedacht, weil in unseren Ländern sitzt der Betriebsrat, also die Gewerkschaft, direkt im Betrieb. Und diese Unterschiede, was ist Betriebsrat und was ist Gewerkschaft, welche Rechte haben wir als Arbeiter, welche Rechte hat Gewerkschaft und Betriebsrat, wussten wir überhaupt nicht. Für uns war unbekannt. Wir haben uns eigentlich diskriminiert gefühlt, ausgegrenzt gefühlt. Und wir haben gedacht, wie konnte die Gewerkschaft so etwas tun? Wir waren doch Arbeiter. Wo war der Unterschied? Warum die deutschen Kollegen und warum wir nicht? Wir waren schon ziemlich niedrig entlohnt. Also das waren schon die Unterschiede. Das haben wir schon gesehen auf unseren Lohntüten. Da und da war der Wut ziemlich groß. Ich denke mir, das Fass war voll.
Greta Civis: Du hattest das gesagt, der Unterschied zwischen Betriebsrat und Gewerkschaften war euch nicht klar. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das heute allen Leuten so klar ist, der Unterschied zwischen Betriebsrat und Gewerkschaften. Nihat Öztürk hat mir dazu auch einen Ton geschickt, den würde ich noch einmal kurz einspielen:
Nihat Öztürk: An der Existenz von autonomen, unabhängigen Gewerkschaften und Betriebsrat sieht man, dass wir in Deutschland eine Art duale Interessenvertretung haben. Beide Institutionen vertreten die Interessen der abhängig Beschäftigten. Sie haben jedoch unterschiedliche Aufgaben und Rechte, die sich sinnvoll ergänzen. Die Gewerkschaften handeln Entgelte und Arbeitsbedingungen aus. Dazu zählen nicht nur die Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen oder Zulagen und Zuschläge, sondern auch zum Beispiel Urlaubsdauer, Urlaubsgeld oder Sonderzahlungen wie Weihnachtsgeld. Aber auch qualitative Elemente wie Verdienstsicherung für ältere Arbeitnehmer und Kündigungsschutz ebenfalls für ältere Arbeitnehmer:innen oder Recht auf Qualifizierung und Altersteilzeit werden durch Tarifverträge geregelt.
Die Rechte des Betriebsrates haben hingegen ganz unterschiedliche Qualitäten. Des Betriebsrates haben hingegen ganz unterschiedliche Qualitäten. Je nach Konfliktfall im Betrieb haben Betriebsräte nur Informationsrechte oder Beratungs- und Mitwirkungsrechte. Aber leider nur ganz, ganz selten Mitbestimmungsrechte. Zum Beispiel bei sozialen Angelegenheiten, jedoch nicht bei wirtschaftlichen Angelegenheiten.
Greta Civis: Und in Heller war es eher so, dass der Betriebsrat dann die Einhaltung der Vorschriften durch die Arbeitenden durchsetzen wollte, oder? Wenn du sagst, die waren nicht so bei euch, oder sie waren bei euch?
Irina Vavitsa: Damals kannten wir das alles nicht und wussten wir das auch nicht. Wir haben so gedacht, die waren nicht auf unserer Seite. Vielleicht für die deutschen Kollegen, ja, aber nicht für uns. Wo war die Vertretung? Wir waren nicht vertreten im Betriebsrat. Für 60 Prozent der Belegschaft, ein Betriebsrat. Und so ist unser Verhandlungsteam zum Arbeitgeber gegangen. Wir haben aber die Arbeit niedergelegt. Das war ein spontaner Streik. Und das, was in den Medien danach war, das war schon nicht fair. Also das war ungerecht. Niemand hat uns von draußen diesen Streik angestiftet. Das war unsere eigene Entscheidung. Weil der Fass war voll.
Greta Civis: Was waren eure Forderungen im Streik?
Irina Vavitsa: Ja, wir waren so bescheiden, wir waren so bescheiden, aber ehrlich, so naiv und so bescheiden. Wir wollten nur 50 Pfennig mehr.
Greta Civis: Und ihr wart erfolgreich?
Irina Vavitsa: Ja, wir waren erfolgreich, weil niemand hat damit gerechnet. Auch wir selber nicht. Wir haben so viel Unterstützung und so viel Solidarität gekriegt. Und ich denke mir, ohne Solidarität, ohne Zusammenhalt, ohne diese Entschlossenheit, wir waren nicht nur einen Tag draußen, wir waren vier Tage lang draußen. Am letzten Tag, am vierten Tag, wir haben gesagt, wir lassen unser Team nicht alleine, unser Verhandlungsteam nicht allein. Wir haben dagestanden und gewarten. Es ist noch unser spanischer Botschafter nach Liebstadt gekommen, um die spanischen Kollegen zum Vernunft zu bringen. Und da haben die spanischen Kollegen gesagt, nein, entweder kriegen wir 50 Pfennig oder wir machen weiter.
Greta Civis: Man muss dazu sagen, für Spanische und für Leute aus Spanien und aus Griechenland war die Situation ja besonders heikel, sage ich mal. Das waren Diktaturen zu der Zeit.
Irina Vavitsa: In Spanien war Franco und in Griechenland war die Situation ja besonders heikel, sage ich mal. Das waren Diktaturen zu der Zeit. Ja, in Spanien war Franco und in Griechenland war Papadopoulos. Und viele meiner Landsleute sind nach Griechenland gefahren im Urlaub und die sind nicht wieder zurückgekommen, weil der Staat wusste schon, also der Staat wusste ganz genau, wo und was, wo war wer aktiv überhaupt? Wer hat was gemacht und wer was gesagt? Das war nicht ohne.
Greta Civis: Mal von euch, also von euch beiden eine Einschätzung. Es ist ja schon spannend. 1973 im Sommer kocht es plötzlich an allen Ecken und Enden der Bundesrepublik hoch. Die Ungerechtigkeit gab es vorher. Es hat sich zugespitzt. Die Lage hat sich verschärft. Und dann überall gleichzeitig legen Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter die Arbeit nieder. Hat es sich einfach so zugespitzt, dass es den Leuten gereicht hat, so viel Druck auf den Kessel, dass es dann geknallt hat oder gab es noch irgendwie andere Faktoren, die das noch befördert haben? Tim, möchtest du mal anfangen?
Tim Zumloh: Tja, das ist die ganz große Frage. Und ich glaube, es ist wahnsinnig schwer, das letztendlich aufzuklären. Wie du schon sagst, das Fass war voll irgendwie. Das ist so ein bisschen das, was man ganz oft rausliest. Es hat einfach jetzt gereicht. Jetzt sozusagen waren wir an einem Punkt, wo uns sozusagen der Kragen geplatzt ist. Aber die Netzwerke dahinter und inwiefern das sozusagen als Bewegung anzuerkennen ist oder zu erkennen ist erstmal, ganz schwierig, ganz schwierig. Und ich weiß nicht, vielleicht kannst du was dazu sagen, Irina, hattet ihr Verbindungen zu anderen Streiks? Gab es irgendwelche Zeitschriften oder Flugblätter, die bei euch kursiert sind?
Irina Vavitsa: Also bei uns, ich muss ganz ehrlich sagen, damals haben wir nicht so viele Kontakte zu anderen Firmen gehabt. Aber die Italiener und die Griechen waren sehr gut organisiert, also politisch organisiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war klar, um was ging damals. Und deswegen habe ich auch entschlossen, in der ersten Reihe zu stehen, obwohl ich war hochschwanger und ich durfte nicht das mitmachen. Ich habe gemacht, weil ich wusste schon, dieser Unterschied zwischen bestimmten Systemen, dieses politische Bewusstsein war bei mir so. Ich wusste ganz genau, mit 15, wer war Rosa Luxemburg und Liebknecht. Ich wusste schon einige Sachen. Ich habe in der Sowjetunion aufgewachsen. Ich war in Griechenland. Ich habe Militärdiktatur erlebt. Und ich war in Deutschland. Und ich wusste ganz genau, was dieses System bedeutet. Warum werden wenige Menschen reich und viele werden arm? Diese Ungerechtigkeit war mir schon bewusst.
Aber das war auch die italienische Kollegin, die war sehr gut organisiert und ich denke mir, durch diese Unterstützung, durch unsere Solidarität, wir haben auch griechische Vereine gehabt, wir haben auch Studentenbewegungen gehabt, wo die haben richtig gegen die Diktatur in Griechenland gekämpft.
Tim Zumloh: Man muss ja auch sehen, es gab davor auch schon Streiks, 1969 auch schon bei Hella und das Besondere aber 1973 ist dann sozusagen, dass diese Streiks 73 sich ganz spezifisch um migrantische Anliegen gedreht haben. Urlaub, ganz wichtig oft, die Unterbringung in den Baracken und eben die Lohnungleichheit zu den deutschen Kollegen und Kolleginnen.
Irina Vavitsa: Ja, wir wollten etwas länger im Urlaub bleiben, weil die Strecke war ziemlich lang. Und das dürfen wir nur drei Wochen Urlaub haben. Wegen auch fünf Wochen Urlaub sind wir auf die Straße gegangen. Also das war nicht ohne. Viele Menschen konnten nicht verstehen, wie konnten wir für fünf Wochen weg. Aber wenn man überlegt, wie lange braucht man nach Türkei zu man überlegt, wie lange braucht man nach Türkei zu fahren mit Auto, wie lange man braucht nach Spanien oder nach Griechenland zu fahren, über 2000 Kilometer, 3000 Kilometer. Also das war schon eine Forderung.
Greta Civis: Ich würde gerne nochmal ein bisschen weiter den Blick weiten auf die anderen westfälischen Streiks in der Zeit. Tim, du hast mir das Thema damals vorgeschlagen, eigentlich mit Hase Winkel und den Traktorproduzenten.
Tim Zumloh: Klaas, genau, Landmaschinenhersteller. Ja, also wir sind ja hier, machen ja Untold History und können aber inzwischen eigentlich schönerweise sagen, dass eben die bekannteren Streiks, wie eben in Lippstadt und vor allem natürlich in Neuss und in Köln, mittlerweile auch wieder sozusagen entdeckt werden und besprochen werden von der historischen Forschung und natürlich auch von Zeitzeugen und Zeitzeugen und auch ganz viel von Aktivistinnen und Aktivisten. Da werden Streiks gestoßen, die, glaube ich, noch komplett unbekannt sind. Und zwar in Harsewinkel bei Klaas. 300, angeblich nur 300, ich glaube, es waren wahrscheinlich mehr, aber laut Presseberichterstattung 300 Arbeiter von Klaas Spanier überwiegend, haben da gestreikt und zwar Anfang Mai 1973, also relativ früh, von einem Freitag bis zu einem Montag. Und dort ging es eben um die Belegung des Wohnheimes.
Dort sollte ein Gemeinschaftsraum geopfert werden, um weitere spanische Arbeitskräfte eben unterzubringen. Und das hat für den Protest gesorgt. Hätte auch zur Folge gehabt, dass die Zimmer von Zwei-Bett-Zimmern zu Drei-Bett-Zimmern hätten erweitert werden müssen. 14 Quadratmeter, damals noch für 60 D-Mark tatsächlich vermietet, also relativ viel, wenn man sich überlegt, wir rechnen vielleicht mit so 300 Euro, 300 Mark Monatslohn, davon dann 60 D-Mark für ein Zimmer auf 14 Quadratmetern. Da kann man sich natürlich vorstellen, dass der Frust sozusagen wächst in diesen Wohnheimen. Diese Gastarbeiter aus Spanien haben dann eben bei Claas insgesamt acht Forderungen gestellt, die sich vor allem auf die Belegung der Heime bezogen haben, aber auch zum Beispiel auch darauf, dass Duschräume beheizt werden sollten, Matratzen sollten ausgetauscht werden.
Also es geht da so um relativ sozusagen kleinteilige Fragen. Aber eben da sieht man sozusagen, dass es irgendwann gereicht hat, dass man irgendwann sagt, okay, es ist gar kein ganz konkreter Anlass, sondern irgendwann platzt einfach so ein bisschen der Kragen. Und das sind halt Fragen und das ist das Zentrale daran, die nur die Migrantinnen betroffen haben. Das haben die deutschen Kollegen gar nicht so wahrgenommen vielleicht. Und deswegen, da rührt, glaube ich, ganz viel auch von dem Unverständnis her, dass dann sozusagen aufgekommen ist. Aber auch in Harsewinkel war dieser Streik dann erfolgreich und hat sich sozusagen durchgesetzt. Und ein toller Fall, der nicht so bekannt ist vielleicht. Und wenn vielleicht jemand zuhört, der Lust hat, dazu zu arbeiten und zu forschen, vielleicht eine gute Idee, das nochmal wirklich im Detail aufzuklären. Weil das ist, glaube ich, nochmal ein schöner Fall. Und gerade auch, wo man sieht, dass es wirklich in die Breite geht, dass es wirklich ganz, ganz viele, auch kleinste Ortschaften erfasst hat.
Greta Civis: Genau und ein weiterer westfälischer Streik war der bei Rheinstahl in Bielefeld. Der ist ziemlich rabiat abgelaufen mit massivem Polizeieinsatz. Ich habe hier einen O-Ton von Klaus Gutbrot.
Der war damals im Betriebsrat und hat sich als Betriebsratsmitglied solidarisiert mit den Streikenden, war dann aber selber auch nach eigener Aussage erschrocken, wie das gelaufen ist:
Das war ein spontaner Streik. Kein Streik, der üblicherweise per Urabstimmung, wie auch immer, durch Mitgliederversammlung. Und die Gewerkschaft war aus ihrer Sicht gebunden an den Tarifabschluss. Man hätte den Tarifabschluss aufkündigen müssen. Das ist aber nicht geschehen. Und insofern hat die örtliche IG Metall den Streik auch nicht unterstützt. Im Gegenteil, sie haben mehrfach versucht Einfluss zu nehmen, den Streik vorzeitig zu wählen. Wir haben von Anfang an versucht, mit den damaligen Falten, sozialistische deutsche Jugend, die Falten, so etwas wie Verpflegung sicherzustellen. Das heißt also, es gab morgens Kaffee, es gab Brötchen, es gab mittags Würstchen oder Suppe, auch Gerichte, die die ausländischen Kollegen gemocht haben. Und es gab einen Speiseplan für die ganze Woche. Das hat natürlich die Werksleitung richtig übel genommen und das fast zum Überlaufen gebracht.
Meines Wissens gab es Verhaftungen, ich glaube sieben oder acht, ich weiß aber nicht mehr genau, die erstmal kaltgestellt wurden. Da spricht sich natürlich auch ganz schnell rum innerhalb der Belegschaft, dass Verhaftungen vorgenommen worden sind. Das schürt natürlich entsprechend die Angst. Und insofern hat das auch damit zu beigetragen. Das heißt, nicht unerheblich war die Polizeipräsenz und die Polizeigewalt in der Auseinandersetzung zum Schluss des Arbeitskampfes. Als ich in aller Frühe in den Betrieb reinging und das sah, war ich entsetzt. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich nehme an, das ist allen anderen Kolleginnen und Kollegen genauso gegangen. So was hat es glaube ich in der westdeutschen Arbeiterbewegung in irgendwelchen Streiksituationen nicht gegeben. Glaube ich jedenfalls nicht und alle waren entsetzt, eingeschüchtert und damit auch richtig konsterniert, weil jeder der am Streik teilgenommen hat, der auch weitermachen wollte oder nicht weitermachen wollte, schon aus Angst vor der Polizeigewalt weitgehend eingeknickt ist. Sehr bedrohliche Situation. Wer weiß, ob nicht einer am Hebel sitzt, durch irgendwelche Umstände einer die Nerven verliert und dann hätte es im Zweifelsfall noch ein Blutbad gegeben.
Klaus Gutbrot schildert da ganz eindrücklich, das ist ein Online-Projekt, Streiks 73 heißt das, verlinken wir auch, schildert da ganz eindrücklich, wie durch die Anwesenheit der Polizei gedroht wurde und tatsächlich dann auch Gewalt eingesetzt wurde. Auch das ist ja was, was man bei Ford gut dokumentiert hat, die tatsächlich auch, die dann noch externe Schläger-Trupps in die Betriebe rein sind, um die Leute wieder zur Arbeit zu kriegen oder um die Geräte nutzen zu können, um weiter zu produzieren durch andere.
Tim Zumloh: Ja, Bielefeld, Brackwede und Rheinstahl, vielleicht so ein bisschen das westfälische Köln in dieser Hinsicht. Also ein Streik, der wirklich dann brutal niedergeschlagen wurde. Es gibt einen sehr anschaulichen Zeitzeugenbericht, der jüngst erschienen ist in einer Publikation der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Können wir gerne auch vielleicht verlinken in der Folgenbeschreibung, von Orhan Çalışır, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, der damals ein Kind war und beschreibt, wie sein Vater und die Kollegen nach dieser Niederschlagung des Streiks nach Hause gekommen sind.
Ganz Brackwede und die Fabrik waren voller Polizei. Sie gingen mit Schäferhunden auf uns los. Was kannst du machen, außer wieder zu arbeiten? Sie waren wütend. Einige fluchten. Ihre Wut richtete sich gegen den Arbeitgeber, gegen die Gewerkschaft, die sich gegen den Streik gestellt hatte. Und vor allem gegen ihre deutschen Kollegen, die Streikbrecher waren. Wenn sie in den Jahren nach dem Streik auf sie trafen, sagten sie noch lange „Schau mal, der hat auch während des Streikes gearbeitet“.
Tim Zumloh: Und das ist, glaube ich, ein anschauliches Zitat, wie schwer das damals war und was das für ein Kampf war, sowohl sozusagen gegen die Polizei als auch gegen die eigenen Kollegen, wo man dann sich erhofft hatte, dass man unterstützt wird, aber es eben keine Solidarität gab. Und der Orhan Çalışır schließt dann sozusagen mit der Feststellung, ja, der Streik endete mit einer Niederlage, aber sie hatten für ihre Rechte gekämpft.
Und da sieht man so ein bisschen, dass dieses grundsätzlich, auch wenn es nicht erfolgreich war, sich überhaupt mal gewährt zu haben. Das hat so viel mit den Menschen auch in den familiären Geschichten und Biografien so viel verändert. Und so viel Power gegeben, dass es sozusagen langfristig auch in den Familien erinnert wird.
Greta Civis: Und mal aus einer Historiker-Perspektive, aus einer Historikerinnen-Perspektive, würdest du sagen, das kann man unterteilen in vor dem Streik und nach dem Streik.
Tim Zumloh: Ich würde das so sehen, ich würde die Migrationsgeschichte insgesamt tatsächlich aufteilen in vor diesen Streiks und nach den Streiks, bin ich gleich auf deine Meinung nochmal gespannt Irina. Ich glaube, das war wirklich ein Wendepunkt. Das war wirklich ein Wendepunkt. Das sieht man auch in ganz vielen Zeitzeugeninterviews, die sagen, es gibt ein Vorher und es gibt ein Nachher. Ab diesen Streiks waren wir selber politisch Handelnde, die selber sozusagen ihre eigenen Standpunkte vertreten haben. Mit den deutschen Kollegen, aber auch gegen die deutschen Kollegen. Das ist ganz wichtig. Und das sozusagen so ein richtiger Wendepunkt dann war. Und man sieht es dann ja auch, wie sich die IG Metall danach zum Beispiel verändert hat.
Greta Civis. Irina, du nickst?
Irina Vavitsa: Wie gesagt, also Fass war voll. Du bist gekommen ja mit einem Koffer voller Hoffnungen und dann erwischst du sowas. Ja, der Lohn war eine Sache, aber das war nicht nur diese ungerechte Entlohnung, sondern auch die anderen Umstände, diese Baracken. Ich wohnte auch in einem Baracken mit meinem Mann in einem Zimmer. Wir mussten alles bezahlen und am Ende des Monats war ganz wenig Geld. Eine Wohnung zu finden, das war sehr schwierig. Also da brauchten Deutschland damals Arbeiter, sind aber junge Menschen gekommen. Wir haben gesagt, Olympia-reife Menschen. Niemand hat gedacht, wir werden auch Familie hier haben. Wir werden auch Kinder kriegen. Darüber hat niemand Gedanken gemacht.
Unsere Kinder waren Kofferkinder. Für drei Monate hier, für einen Monat hier, einmal mit Opa, einmal mit Oma und wieder weg. vier, vier Einwohner, einmal mit Opa, einmal mit Oma und wieder weg. Kann die Kinderbetreuung, kann die Kindertagesstätte. Ich kannte jetzt von meiner ersten Heimat, da hat jeder Betrieb einen Kindergarten, ihr aber nicht. Und sobald wir den Mund aufgemacht haben, haben wir gesagt, warum, dieser große Unternehmen hat keinen Kindergarten. Was haben die uns gesagt? Wir sind nicht im DDR. Das brauchen wir nicht. Ja, und so unsere Kinder waren Kofferkinder.
Greta Civis: Tim?
Tim Zumloh: Du hast nochmal in einem Interview gesagt mit unserer Kollegin Thordis Kokot. Wir verlinken den Beitrag in der Podcast-Beschreibung. Hast du mal gesagt, man wird zweifach bestraft. Erstens als Migrantin, zweitens als Frau.
Irina Vavitsa: Das stimmt. Wir hatten für die gleiche Arbeit, wir haben die Unterschiede gesehen, im Lohntüten, also in der Abrechnung. Ich habe mit meinen deutschen Kollegen die gleiche Arbeit gemacht, aber ich weniger gehabt. Und ein deutscher Mann hat mehr gehabt. Also wir als Frauen. Wir ausländische Frauen, wir waren zweimal bestraft.
Greta Civis: Gehen wir nochmal zurück auf vor dem Streik und nach dem Streik. Was war nach dem Streik anders als vor dem Streik? Das Selbstbewusstsein von euch als Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern. Tatsächlich hat sich strukturell was geändert? War es besser? Kamt ihr eher durch? Ich habe noch ein Statement von Nihat Öztürk von Seiten der Gewerkschaft dazu:
Nihat Öztürk: Auch wenn die spontanen Streiks an den Gewerkschaftsvorständen vorbei und ohne U-Abstimmung durchgeführt wurden, die Streikenden waren in der Regel Gewerkschaftsmitglieder. Und die Streiks richteten sich ausschließlich gegen die Arbeitgeber. Die Ziele der Streiks wurden auch von den betroffenen Arbeitnehmer:innen selber bestimmt. Insofern waren das alles wirklich autonome, selbstbewusste Streiks gewesen. Diese spontanen Streiks haben die Gewerkschaften nicht geschadet, sondern im Gegenteil, sie haben die Gewerkschaften enorm gestärkt. Der beste Beweis dafür sind die in dieser Zeit sprunghaft angestiegenen Mitgliederzahlen, aber auch die Politisierung und das gestiegene Selbstbewusstsein von Gewerkschaftsaktivisten.
Ein zweites Beispiel für die positiven Wirkungen dieser spontanen Streiks ist der Abschied von Paternalismus und der Beginn einer aktiven Migrationspolitik der Gewerkschaften. Denn erst nach dem Fortstreik fingen die Gewerkschaften an, die Ansprüche der Migrantinnen nach Anerkennung oder nach demokratischer Teilhabe ernst zu nehmen.
Greta Civis: Siehst du das auch so? Hast du das damals so wahrgenommen, dass sich nach dem Streik das Bewusstsein in der Gewerkschaft für die, ich sage jetzt mal, im damaligen Jargon ausländischen Kollegen, Kolleginnen waren wahrscheinlich nicht erwähnt, so dass sich das gestärkt hat, dass sich das geändert hat?
Irina Vavitsa: Ja, ich sage jetzt Gott sei Dank hat die Gewerkschaft live erlebt, wo wir bereit waren zu tun. Also wir waren bereit, für unsere Rechte zu kämpfen. Und dann haben die gedacht, ja, warum haben wir diese Menschen ausgeschlossen? Ja, haben wir gesagt, endlich haben die kapiert.
Greta Civis: Und du bist nach dem Streik auch in die Gewerkschaft dann eingetreten?
Irina Vavitsa: Wieder.
Greta Civis: Vorher ausgetreten?
Irina Vavitsa: Ja, ausgetreten und dann wieder eingetreten. Und dann hat die Gewerkschaft entschlossen, weil wir waren nirgendwo vertreten gewesen. Und da sind wir integriert in alle gewerkschaftlichen Strukturen. Jede von uns war für die Personengruppe. Also sind gewerkschaftliche Strukturen im Betrieb. Das heißt VK- Leitung, Vertrauenskörperleitung, ist eine gewerkschaftliche Sprache. Jede von uns, jede Personengruppe war vertreten. Also ich war für die Griechen und die spanischen Kollegen für die Spanier, Italiener, also alle vier Personengruppen waren vertreten. Und das war ziemlich wichtig, weil wir konnten mit unseren Kollegen in unserer Landessprache sprechen. Wie war diese, wie soll ich sagen, Kontaktperson. Also wenn ein Kollege hat ein Problem im Betrieb, da haben die zu uns gekommen und wir sind zum Betriebsrat gekommen. Wie war die? Transporteur, sage ich jetzt. Aber das funktioniert ziemlich gut. Also zu mir konnte jede griechische Frau oder jeder griechische Kollege was zu sagen, anstatt sofort zum Betriebsrat zu gehen.
Greta Civis: Ansonsten, wie ist es insgesamt? Ich habe schon rausgehört, es ist besser geworden oder ist es einfach anders geworden?
Irina Vavitsa: Anders geworden. Anders geworden, ja, in bestimmten Bereichen besser. Ich sage, was ich jetzt kann über IG Metall reden, das ist klar besser, aber es ist nicht erreicht, das, was wir wollten. Noch nicht. Noch nicht.
Greta Civis: Und wenn du mal einerseits prognostizierst, es ist jetzt ungefähr 50 Jahre her, wenn wir nochmal 50 Jahre in die Zukunft gucken, wie ist es dann? Und dann auch träumst. Was würdest du dir wünschen?
Irina Vavitsa: Gott sei Dank, ich träume. Ich bin eine Optimistin. Ich hoffe, es wird besser. Zurzeit bin ich sehr traurig, sehr verärgert. Ja, der Rechtspopulismus steigt. Es ist anders geworden. Früher haben wir immer wieder Angst gehabt. Also wenn du einen Fehler gemacht hast im Betrieb, oder du hast diesen Fehler erwähnt, oder es war eine Ungerechtigkeit im Betrieb, dann haben die Kollegen gesagt, ja, wenn dir gefällt nicht, bitte schön, da ist die Tür. Du kannst wieder gehen. Ja, wo soll ich hingehen? Wir haben die ersten Jahre, wir haben wirklich provisorisch gelebt. Aber richtig provisorisch, weil du warst nicht richtig in deinem Land und du warst nicht richtig hier. Weil bei jeder wirtschaftlichen Krise, die ersten sind die Migranten gegangen, die ungelernten Arbeitskräfte gegangen, genau wie heute. Wenn Transformationen stattfinden, ja, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund sind qualifiziert? Vielleicht viel mehr als früher, aber trotzdem die ersten gehen diejenigen, die sind unqualifiziert. Die einfache Arbeit wird verlagert.
Tim Zumloh: Und ich frage mich, kann man vielleicht sagen, also vor 73 ging es sozusagen um die Arbeit, nach 73 ging es um das Leben in Deutschland.
Irina Vavitsa: Ja, weil wir haben entschlossen, eher zu bleiben. Wir wollten nicht zu gehen, obwohl damals gab es Möglichkeiten, also die haben diese „Hauab“ -Prämie gegeben, damit die Leute schnell loswerden, Leute schnell weggehen. Die Arbeitsplätze für Deutsche so ein bisschen anders verpackt. Nicht so wie heute, sagen erst mal die Deutschen, und dann „Deutschland für Deutsche“. Ja, dann haben wir, die meisten haben wir entschlossen, hier zu bleiben, weil in Griechenland war noch schlimmer, wo sollen wir hingehen?
Jetzt geht es um die Gerechtigkeit, um Gleichberechtigung, um gleiche Chancen, weil, wo sind unsere Kinder? Ich weiß noch, damals die Lehrer in der Schule zu mir gesagt, ja, deine Kinder müssen zur Hauptschule. Das war schon ärgerlich. Warum? Waren unsere Kinder alle so doof? Und unsere Kinder haben studiert hier. Und heut auch unsere Enkelkinder. War damals nicht zu denken. Es konnte mein Enkelkind im Landtag im Düsseldorf ein Praktikum erhalten. Das war unglaublich.
So, jetzt reden wir über Gleichstellung. Wir sind so lange hier, das ist unsere Heimat. Wo bin ich zu Hause? Wenn ich schon auf Deutsch denke, wo bin ich zu Hause? Ich habe hier meine Freunde, ich habe hier meine Verwandten, ich habe meine Kinder, meine Enkelkinder. Hier sind schon vier Generationen von meiner Familie. Wo bin ich zu Hause? Und dann reden wir über Europa. Über welche Europa? Damit die die Arbeitgeber verlagern, kann jeder Moment, da wo die billig produziert wird, aber wo sind unsere Menschenrechte hier? Ich denke mir, Wahlrecht ist Menschenrecht. Wenn ich lebe, ich möchte nicht über die Deutschen entscheiden. Ich möchte mit entscheiden, was passiert in Liebstadt. Bleibt das Krankenhaus in Liebstadt oder nicht? Wird eine Schule gebaut oder nicht? Wird ein Theater gebaut oder nicht? Es geht mich an. Es geht um mein Leben und nicht nur um mein Leben, sondern um meine Kinder und meine Enkelkinder.
Greta Civis: Tim, auch von dir nochmal ein bisschen der Status quo. Wie ist es heute im Unterschied zu damals? Ist es anders, ist es besser? Und auch der Blick in die Zukunft, wenn du möchtest, einmal die Prognose oder der Traum oder beides?
Tim Zumloh: Also im Vergleich, was so ein bisschen zurückgegangen ist, sind diese großen Fabriken. Und was ihr damals hattet, Irina, waren zweieinhalbtausend Leute in einer Halle sozusagen. Und das wird tendenziell ein bisschen weniger und es wird schwerer werden. Es ist schwieriger geworden, diese Solidarität zu bekommen und dieses Gruppengefühl und die Leute einfach zusammenzubringen, weil sich der Jobmarkt so weit ausdifferenziert. Und diese klassische Industriearbeit geht ein bisschen zurück. Und eben sowas wie der Lieferdienstmitarbeiter, der ist erst mal alleine. Und dann hat er dieselben Probleme, die du auch beschrieben hast. Kennt er die Gewerkschaft? Kennt er überhaupt den Betriebsrat? Gibt es überhaupt einen Betriebsrat? Und es ist immer schwieriger geworden, die Menschen zu organisieren in größeren Gruppen.
Irina Vavitsa: Was ich finde ziemlich wichtig und was wir heute machen, wir haben viele aus Osteuropa neue Arbeiter und die arbeiten nicht unbedingt unter besten Bedienungen. Und da ist in kleinen Betrieben, wo kein Betriebsrat und wo kein Gewerkschaft ist. Und da sind wir mit unserer Roadshow unterwegs. Wir haben Flyer in 17 unterschiedlichen Sprachen, von Arabisch, Syrisch, Polnisch, Tschechisch, Slowakisch, Rumänisch, alles Mögliche. Und da sind wir da, die Kollegen zu zeigen, ihr seid nicht alleine.
Ich habe nie gedacht, vor 60 oder vor 50 Jahren, das kommt immer wieder so was wie früher bei uns. Und das haben wir jetzt wieder. Nicht so schlimm wie damals, aber immer noch schlimm genug. Und da sind wir Menschen zu unterstützen. Wir waren bei Tesla, Kollegen zu unterstützen, auch in anderen Betrieben. Wir sind unterwegs, öfter mit unseren Flyern, mit unseren Informationen Menschen zu informieren, was ist Betriebsrat, was ist Gewerkschaft, warum ist es wichtig, einen Betriebsrat zu haben im Betrieb, warum ist es wichtig, in der Gewerkschaft organisiert zu sein. Also das finde ich klasse und ich denke mir, das haben wir geschafft, als wir Migranten, klar, mit Unterstützung von deutschen Kollegen, aber das hat beschlossen auch der Vorstand.
Wir haben einen Bundesmigrationsausschuss, wir haben bezirkliche Ausschüsse, wir haben örtliche Ausschüsse, wo wir uns mit unseren Themen beschäftigen und dann verlangen wir von der Gewerkschaft sowas auch. Diese Unterstützung für die Kollegen. Und da versuchen wir Menschen zu überzeugen, warum es wichtig ist, eine Gewerkschaft zu haben. Was hat uns unsere Streit gezeigt, 1973? Es reicht nicht, den Mut zu haben, auf die Straße zu gehen. Du musst wirklich in der ersten Reihe sein du musst eine Gewerkschaft sein, eine starke Gewerkschaft haben, ein Bewusstsein für Klassengewerkschaft haben, sage ich jetzt von mir. Damit er den Weg zeigt und du folgst, auch wenn du nicht immer in der ersten Reihe bist, auch in der zweiten Reihe. Aber du brauchst unbedingt eine starke Gewerkschaft.
Greta Civis: Dankeschön. Gut, also ich glaube, wir haben eine ganze Menge angerissen und auch einiges gelernt. Ich auf jeden Fall zum einen, wie wirklich so der Blick auf ein historisches Ereignis, die spontan ungeplanten, mit der Gewerkschaft nicht, mit dem Betriebsrat nicht abgesprochenen, abgestimmten Arbeitsniederlegungen von 1973 uns den Blick öffnen auf vielfältige Arten von Diskriminierung, die es gibt; sowohl innerhalb der Gastarbeiter:innen, dass da differenziert wurde in verschiedene Gruppen, verschiedene Herkünfte, dann nochmal zwischen Männern und Frauen und dann die Erkenntnis für mich, dass es im Bereich der Migrationsgeschichte, vielleicht auch im Bereich der Arbeitsgeschichte in Deutschland ein Vor-73 und Nach-73 ging und ich finde es einen sehr schönen Satz, Vor-73 ging es um die Arbeit, Nach-73 ging. Da werde ich noch weiter dran denken.
Ganz lieben Dank euch beiden, dass ihr teilgenommen habt. Ganz lieben Dank auch nochmal Nihat Öztürk und allen anderen, die im Vorfeld mit mir telefoniert und darüber geredet haben und dazu gearbeitet haben. Es gibt ganz viel Material online. Wir schreiben das in die Folgenbeschreibung.
In der nächsten Folge von Untold Stories besprechen wir ein Frühwerk der Filmgeschichte. Vor wenigen Wochen wurde der Stummfilm „Der Friedensreiter“ von 1918 feierlich im Cinema in Münster präsentiert. Lange galt der Film als verschollen, nun ist er wieder da. Markus Köster, Leiter des LWL Medienzentrums und Bernd Thier vom Stadtmuseum Münster besprechen die Zeitschichten des ersten westfälischen Spielfilms mit mir. Ganz herzlichen Dank und bis dann.
Regionalgeschichte auf die Ohren. Untold Stories. Westfalens verborgene Geschichten erzählen. Dieser Podcast ist eine Koproduktion des LWL Medienzentrums für Westfalen und des LWL-Instituts für westfälische Regionalgeschichte. Das Projekt wird von der LWL Kulturstiftung im Rahmen des Kulturprogramms zum Jubiläumsjahr 2025, 1250 Jahre Westfalen, gefördert. Schirmherr des Kulturprogramms ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.