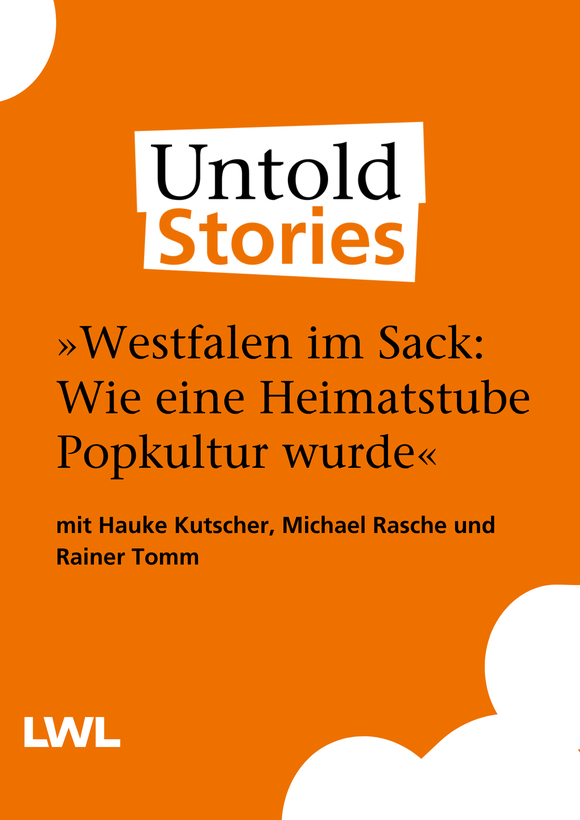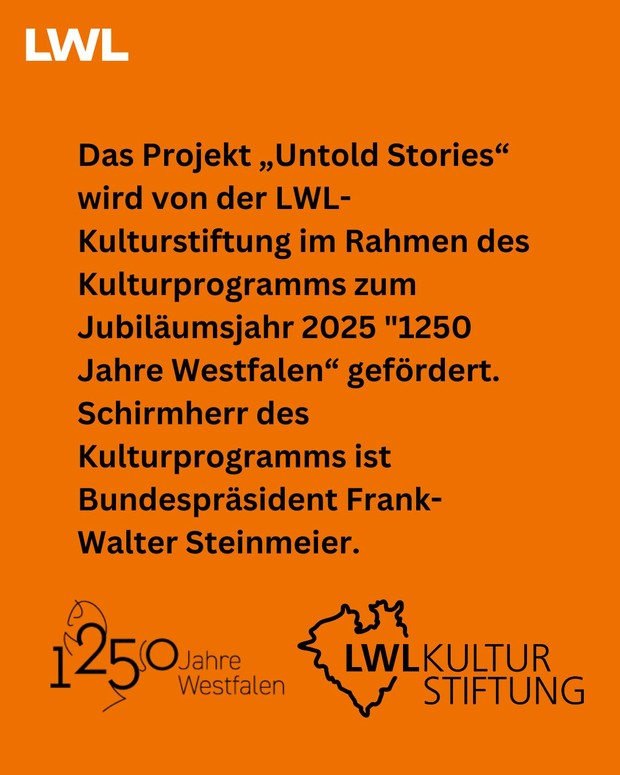Transkript
Regionalgeschichte auf die Ohren
Greta Civis: Eine Babywiege, Waschschüsseln, eine Küchenhexe, Schaufensterpuppen mit Kleidung und fast immer die Schule von früher. Schiefertafel mit Holzpulten, manchmal sogar ein Rohrstock. Es knarrt und knarzt. Ganz klar, wir sind in einem Heimatmuseum. Gefühlt gibt es sie in jedem Ort. Heimatmuseen, Heimatstuben oder auch Dorfmuseen. Dort wird, meist ehrenamtlich, die Vergangenheit gezeigt und es ist irgendwie immer die gleiche Vergangenheit, die gleiche Heimat.
Der Heimatverein Nieheim hat in den letzten 25 Jahren einen besonderen Weg gewählt, der dem kleinen Ort deutschlandweite Bekanntheit verschaffte. Von Wetten, dass... bis Böhmermann. Denn dort, zwischen Paderborn und Höxter, gibt es zwar ein Heimatmuseum mit allem, was man dort erwartet, aber auch ein Sackmuseum. Klingt lustig, ist es auch. Selbstironisch, aber irgendwie auch wirklich erhellend ist der Blick durch alte und neuere Säcke auf Dinge, die für ein Gefühl von Frühjahr stehen.
Einen Besuch im Sackmuseum nutze ich heute für ein Gespräch über das Phänomen Heimatmuseum mit
Hauke Kutscher: Hauke Kutscher
Greta Civis: vom LWL-Museumsamt. Und durch das Sackmuseum geführt haben mich Michael Rasche und Rainer Tom vom Heimatverein Nieheim, denen ich dafür sehr danke.
Westfalen im Sack. Wie eine Heimatstube Popkultur wurde.
Lieber Hauke, du arbeitest beim LWL-Museumsamt. Was macht das LWL-Museumsamt und was machst du dort?
Hauke Kutscher: Ja, das LWL-Museumsamt ist eine Kulturdienststelle des LWL. Der LWL hat den gesetzlichen Auftrag, die Heimatmuseen zu fördern und zu pflegen, so heißt es in der Landschaftsverbandsordnung; und das macht er unter anderem eben über das Museumsamt. Das ist eine beratende Institution in erster Linie. Also wir unterstützen die Museen vor Ort durch fachliche Beratung. Wir unterstützen sie aber auch, wenn Fördervoraussetzungen erfüllt sind, auch mit finanzieller Unterstützung. Und wir haben bestimmte Serviceleistungen, die wir anbieten, zum Beispiel Wanderausstellungen, die wir entwickeln, die die Museen kostenfrei bei uns entleihen können, zeigen können oder auch Fortbildungen zum Beispiel, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Museen zu qualifizieren.
Greta Civis: Das heißt, ihr seid nicht oder nicht nur für die LWL-Museen zuständig, sondern für alle Museen in Westfalen und auch nicht nur für Heimatmuseen, sondern für die Gesamtheit der Museen in Westfalen?
Hauke Kutscher: Ja, genau. Also für die LWL-Museen sind wir im Kern gar nicht zuständig. Also manchmal rufen uns auch Leute an und denken, wir sind sozusagen die Oberaufsicht der LWL-Museen. Das sind wir gerade nicht, sondern wir kümmern uns um die anderen Museen im Land. Der Blick ist da immer sehr stark auf die kommunal getragenen Museen, weil der LWL natürlich als Kommunalverband dort die Mittel herbekommt und auch wieder dorthin auch zurückfließen lässt. Aber es sind eben auch, alle anderen Museen können sich von uns beraten lassen. Das sind vereinsgetragene Museen beispielsweise, gibt es sehr viele. Und es gibt aber auch private Museen, es gibt Firmenmuseen. Die können wir zum Beispiel nicht fördern mit Steuermitteln, aber wir können alle Museen in Westfalen beraten und tun das auch, wenn wir da angefragt werden.
Greta Civis: Und was sind das für Häuser? Was gibt es für Museen in Westfalen? Kannst du so ein paar Highlights nennen?
Hauke Kutscher: Ja, also wir haben, ich meine, das finde ich halt sowieso das Tolle natürlich an der Museumslandschaft, dass sie so unglaublich divers ist. Also Westfalen hat eine ganz hohe Museumsdichte, also wir zählen in unserer Liste so 670, 680 Museen und zum Beispiel das Institut für Museumsforschung in Berlin, die zählen bundesweit zu etwa 7000 Häuser. Das heißt sozusagen 10 Prozent der Museen in Deutschland liegen in Westfalen. Das ist so ein bisschen grob, weil immer die Frage ist, was sind genau die Zahlen, was ist die Bezugsgröße. Aber wir haben sehr viele Museen und wir haben sozusagen auch dadurch die ganze Bandbreite.
Das ist einmal, haben wir sehr große Museen, also natürlich auch die LWL-Museen gehören natürlich dazu, wenn wir denken hier an Kunst und Kultur oder das Naturkundemuseum in Münster oder das Freilichtmuseum in Detmold. Das sind große Museen ihrer Art. Es gibt die ganz kleinen Museen, die vereinsgetragenen, ehrenamtlich geführten Museen. Und wir haben halt auch sämtliche Museumssparten und Genres. Also die schon erwähnten Heimatmuseen, das ist eine sehr große Anzahl. Aber es gibt eben Kunstmuseen, es gibt archäologische Museen, technische, naturwissenschaftliche Museen. Also es ist eine unglaublich bunte und breite Landschaft, bei der natürlich auch für jeden und jede was dabei ist.
Greta Civis: Die Podcast-Folge erscheint voraussichtlich im Herbst. Das ist eine gute Zeit, ins Museum zu gehen. Welches, abgesehen von dem, was wir gleich auch noch besuchen, welches würdest du dringend empfehlen?
Hauke Kutscher: Ja, mir liegen viele Museen am Herzen und das ist natürlich immer so ein bisschen gemein, so einzelne Sachen rauszupicken. Also ich finde, also ein kleines Highlight, was nicht so bekannt ist, ist zum Beispiel in Lemgo das Junkerhaus. Das ist eigentlich ja ein Fachwerkgebäude von einem Künstler, Junker, der hat mit Holzschnittsarbeiten gearbeitet und der hat dieses ganze Haus wahnsinnig verziert mit diesen Arbeiten. Und das ist sozusagen, glaube ich, viel zu wenig bekannt. Das ist ein echtes kleines Highlight. Das ist ein kommunales Museum. In Lemgo gehört dort zu den städtischen Museen. Also das wäre auf jeden Fall ein Knaller.
Greta Civis: Und wir sind da gerade schon dran langgeschrammt, weil du so ein bisschen sagtest, es ist auch immer die Frage, wie man zählt. Knapp 700 Museen, 7000 Museen. Was ist ein Museum? Was macht ein Museum aus? Was unterscheidet meine private Sammlung von Briefmarken von einem Museum?
Hauke Kutscher: Ja, okay.
Greta Civis: Ich habe keine Briefmarkensammlung.
Hauke Kutscher: Ja, also ich glaube, die meisten Menschen wissen ja, Also wenn ich sage Museum, dann haben die meisten Leute doch irgendwie was im Kopf. Also ich glaube, dass es praktisch niemanden gibt, der keine Erfahrung mit einem Museum hat. Und man stellt sich meistens eben einen Ort vor, häufig ein Gebäude, in dem halt Dinge zu sehen sind, die nicht mehr irgendwie im Gebrauch sind, also die man aus ihrem ursprünglichen Kontext entnommen hat und die man da jetzt eben anschauen kann. Das wäre so eine lebensweltliche Herangehensweise. Deine Privatsammlung unterscheidet sich, die du nicht hast, aber wenn du sie hättest, unterscheidet sich von einem Museum dadurch, dass deine Privatsammlung erstmal nicht öffentlich zugänglich ist.
Das ist ein wichtiger Punkt in der Frage, was ist ein Museum? Das ist eben ein öffentlich zugänglicher Ort. Und das ist eben auch Teil der Museumsdefinition. In der Fachwelt gibt es natürlich, wenn man diese Spannung nimmt, von einem lebensweltlichen Zugang, wo wir alle ein Gefühl haben, wir wissen, was sind Museen und fachlich wird natürlich dann nochmal diskutiert, was ist jetzt total wichtig, was sind die wesentlichen Merkmale. Da gibt es eben eine Definition vom Internationalen Museumsrat und die sagt eben auch, es muss öffentlich zugänglich sein. Es werden in dieser Definition Kernaufgaben benannt, die so ein Museum erfüllt, das Museum sammelt, es bewahrt und erforscht eben Dinge, es interpretiert diese Dinge und es stellt sie auch aus. Das sind so Aufgaben.
Und es gibt natürlich auch noch weitere Merkmale, die gerade in jüngster Zeit sehr stark diskutiert wurden, nämlich was für eine öffentliche oder gesellschaftliche Rolle haben diese Einrichtungen eigentlich. Das ist auch ein wichtiger Punkt und das fällt natürlich bei einer privaten Sammlung weg.
Greta Civis: Und mit dieser Definition, sammeln, bewahren, erforschen, vermitteln, seid ihr auf ungefähr 700 Einrichtungen in Westfalen gekommen, die dann 2022 für die Museumsbefragung angeschrieben wurden und dann hat so ungefähr die Hälfte geantwortet.
Hauke Kutscher: Ja.
Greta Civis: Und von denen waren 43 Prozent Vereins getragen und zwar meistens von einem Heimatverein.
Hauke Kutscher: Ja.
Greta Civis: Das heißt, wenn ich das mal so extra poliere, komme ich auf um und bei 300 Heimatmuseen oder Heimatstuben in Westfalen.
Hauke Kutscher: Ja, also ich vermute, es ist natürlich so, es hat nicht jedes Museum, was wir angeschrieben haben, eben geantwortet. Und die Frage, wer antwortet, ich vermute sogar, dass der Anteil etwas höher ist. Also in unserer Adressdatenbank, wenn ich mal so sage, da führen wir etwas mehr als 50 Prozent Museen auf, die von Vereinen getragen und betrieben sind, also in der Regel ehrenamtlich betrieben sind. Manchmal gibt es auch hauptamtliches Personal, aber der große Anteil ist eben tatsächlich von Vereinen und mit ganz viel Ehrenamt.
Greta Civis: Und ich habe die Gelegenheit genutzt und bin nach Nieheim gefahren und habe mir dort so ein Museum angeschaut. Allerdings ein bisschen ein anderes Museum als vielleicht die ganz klassische Heimatstube. Und zwar das Nieheimer Sackmuseum.
Michael Rasche: Nehmen Sie Platz. Möchten Sie noch ein Wasser?
Greta Civis: Ne, ich habe hier noch, danke:
Ich treffe Michael Rasche, den ersten Vorsitzenden, und Rainer Tom, den zweiten Vorsitzenden, die mir das Museum zeigen.
Michael Rasche: Das Haus hier, das ist früher mal ein Kornhaus gewesen. Hier wurde ja Getreidehandel oder Landhandel betrieben. Und das Getreide, das wurde ja zum Beispiel auch in Säcken angeliefert. Futtermittel, die wurden dann in Säcken hier wieder mit zurückgenommen. Und was liegt da näher, wenn man so ein Gebäude macht, wie zu sagen, wir machen ein Sackmuseum. Ich habe mir sagen lassen dass da seinerzeit… Es gab einen im Heimatverein der hat gesagt ich habe zu Hause auch noch so viele Säcke, lasst uns kein Heimatmuseum machen, lasst uns hier ein Sackmuseum machen. Und dieses Sackmuseum, das wollten die anderen gar nicht. Die haben gesagt, du spinnst. Wie kann man ein Sackmuseum machen? Das ist auch jetzt 25 Jahre her. Und wir machen das Heimatmuseum.
Ja, und der Kollege, der durfte sich dann ganz oben auf dem Boden ausbreiten. Ja, und das hat er gemacht. Und im Laufe der Zeit ist es immer mehr so, das Sackmuseum im Heimatmuseum und die verschiedensten Titel hat das gehabt. Und als wir das übernommen haben, haben wir gesagt, wir müssen schon dieses Alleinstellungsmerkmal, das müssen wir auch für uns nutzen. Und deshalb haben wir dann jetzt draußen nur noch dran Sackmuseum. Das wird alles irgendwann im Laufe der Zeit nur noch auf Sackmuseum laufen, weil das ist eben das Sackmuseum.
Greta Civis: Drinnen steht man zunächst also im Veranstaltungsraum. Dort gibt es Konzerte, Waffelbacken, Kabarett, Versammlungen von Vereinen, auch private Feiern nutzen die Räume. Das Alleinstellungsmerkmal Sack trägt tatsächlich so gut, dass es einen durch den ersten Stock, das eigentliche Heimatmuseum, begleitet.
Rainer Tom: Spielt sich alles um Säcke und um Tüten.
Michael Rasche: Säcke, Beutel, Tüten, das gehört alles zusammen irgendwo. Und das sind so Sachen, die sich dann auch vielleicht gefunden haben. Wenn man jetzt sieht, das war ja ursprünglich die Etage des Heimatmuseums. Dann hat man das aufgebaut und auf einmal hat man dann vielleicht festgestellt, Mensch, wir haben hier eine Kinderecke, da gibt es einen Lachsack. Oder da gibt es das Sandmännchen, was den Sandsack dabei hat. Die gute Stube, die wurde natürlich geheizt mit Kohle, Kohle aus dem Sack. Dahinter wurde der Schornstein sauber gemacht und dann kam der Schornsteinfeger mit dem Russsack. Das wurde da reingefegt.
Greta Civis: Man sieht also, Säcke gibt es überall. Im Dachgeschoss des Hauses gibt es dann eigentlich nur noch Säcke.
Michael Rasche: Gehen wir mal einen höher nochmal. Sie hatten eben gefragt ob wir öfters so Werkstätten auch oder sowas bekommen das ist zum Beispiel tatsächlich die Werkstatt von Otro Österling, der hat eine Sackflickerei am Nord-Ostsee Kanal gehabt. Er hat dort früher dort die säcke von den Schiffen oder die wurden ihm gegeben zum Flicken und als das nicht mehr lief haben sie gesagt, dann bringen wir das mal ins Niheimer Sackmuseum.
Früher wurden die Säcke zum Beispiel, die wurden bemalt, wenn sie den da sehen, das ist handbemalt. Jeder Landwirt, der hatte seinen eigenen Sack, den er zur Mühle brachte und er hat den dann hinterher auch wieder bekommen. Und deshalb gab es Sackmaler, die gingen von Ort zu Ort, von Haus zu Haus und haben dann da ihre Dienste angeboten und da die Säcke bemalt.
Tom Rainer: Es gibt so viele Geschichten rund um die Säcke. Ja, wie gesagt, hier haben wir jetzt noch die Sackreinigungs- und Wendemaschine. Ich kann Ihnen das auch gerne mal zeigen, wenn Sie das möchten.
Greta Civis: Die Sackreinigungs- und Wendemaschine macht jedenfalls ordentlich Krach. Sonst macht sie, was ihr Name verspricht, sie macht den Sack sauber und wendet ihn. Neben etwas Blödelei gibt es hier auch wirklich Interessantes zu erfahren. Über ausgestorbene Berufe wie den Sackflicker und den Sackmaler, über logistische Lösungen vergangener Zeiten. Informationen in Text sind eher spärlich. Objekte, vor allem Säcke, gibt es dafür sehr viele.
Für den Nieheimer Heimatverein funktioniert sein Konzept jedenfalls. Michael Rasche verweist noch auf die Google-Bewertung.
Michael Rasche: Ich weiß nicht, ob Sie da schon mal geschaut haben, da sind wir besser wie der Louvre in Frankreich. Also wenn ich irgendwo hinkomme und es gibt irgendwo ein Museum, dann schaue ich, wie ist das bewertet. Und weniges ist so gut bewertet wie das Sackmuseum in Nieheim.
Greta Civis: Hauke, was würdest du sagen, was ist am Nieheimer Sackmuseum eigentlich typisch für ein Heimatmuseum und was ist eher unüblich?
Hauke Kutscher: Also typisch ist das bürgerschaftliche Engagement. Es ist ehrenamtlich getragen, es kommt aus der Stadtgesellschaft heraus, wird das entwickelt. Man will sowas machen, es ist ein Heimatverein, der dahinter steht mit Menschen, die sich dort stark engagieren. Typisch ist auch, dass man ein historisches Gebäude hat und da taucht halt oft die Frage auf, ja, was machen wir denn jetzt damit? Also es ist da ja, glaube ich, ein ehemaliger Landhandel. Und dann ist, ja, du hast es, glaube ich, auch schon mal erwähnt, die Schulmuseen oder in deiner Einleitung, das ist auch so ein ganz typischer Fall. Also irgendwann schließen diese Dorfschulen und dann kommt die Frage auf, was machen wir damit? In Nieheim ist es eben ein Landhandel und da hat man dann eben diese Säcke gefunden und gesagt, ja, das ist auch etwas, was mit diesem Ort zu tun hat.
Greta Civis: Es gibt ja auch dieses Klischee, dass das oft pensionierte Lehrer sind oder Lehrer, die sich dann nebenbei um diese Heimatvereine und Museen gekümmert haben. Ich habe mal so im Kopf der Lehrer, der Apotheker, der Pfarrer, die gründen den Heimatverein.
Hauke Kutscher: Das mag sein. Also da bin ich jetzt tatsächlich ein bisschen überfragt, aber ich mache mir heute eher andere Gedanken zu, weil es heute halt häufig schwierig ist, Leute zu bekommen, die sich da engagieren. Und die Lehrerinnen und Lehrer, die jetzt so in den kleineren Städten arbeiten, die leben da oft nicht mehr. Aber das ist sicherlich ein Zusammenhang. Auch die Frage, warum mache ich das denn? Und wenn ich jetzt Lehrerinnen und Lehrer bin und ich möchte irgendwie was vermitteln, dann habe ich natürlich auch ein Motiv, mich für sowas zu engagieren. Ob das jetzt in Nieheim der Fall war, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Aber solche Heimatstuben oder kleinere Heimatmuseen gibt es ja auch schon länger. Also das Phänomen gibt es seit Anfang des 20. Jahrhunderts mindestens. Und da gibt es halt auch solche Zusammenhänge.
Greta Civis: Es gab auch richtig Boomphasen in der Entstehung von Heimatstuben und Heimatmuseen.
Hauke Kutscher: Ja, das ist auch im 1900 so der Fall. Also da passiert das auch. Und wir haben so der jüngere Museumsboom, von dem wir immer reden, der ist so Mitte der 70er bis Mitte der 80er Jahre. Und dann gibt es eben auch Neugründungen eben nicht nur von vereinsgetragenen Museen, sondern eben auch von kommunal getragenen Museen, staatlich getragenen Museen. Und ich glaube sozusagen in dieser Bugwelle schwimmen dann auch die Heimatvereine mit. Also es gibt einfach so ein starkes Interesse plötzlich an Musealisierung und dann gibt es diese Gründung.
Allerdings zum Beispiel bei unserer Museumsbefragung, die du erwähnt hast, ist auch rausgekommen, ich glaube ein Drittel der Museen, die da geantwortet haben, haben gesagt, sie sind erst nach 1990 gegründet worden. Das fand ich total interessant daran. Das hätte ich nämlich nicht gedacht. Man hat immer diesen Bogen so im Kopf, aber der scheint irgendwie so ein bisschen weiter zu gehen auch.
Greta Civis: Und warum? Also was ist das für ein Bedürfnis? Die Küchenhexe, die gute Stube, die Wäsche ohne Waschmaschine, das immer wieder zu zeigen. Warum wird das gemacht? Warum wurde das gemacht?
Hauke Kutscher: Ich glaube, es gibt auch nicht ein Motiv. Also ich persönlich glaube, es gibt Menschen, die sammeln gerne. Ich glaube, das ist so eine Sache, mit der man sich auseinandersetzen muss. Ich selber mache das nicht. Ich halte das auch für einen Vorteil, wenn man im Museum arbeitet, wenn man nicht selber so eine ganz persönliche Sammelleidenschaft hat, weil es oft eine Vermischung dann mit dem Beruflichen gibt. Aber es gibt natürlich einfach so ein Interesse. Ich habe eine Sammlung und ich möchte die zeigen.
Bei den Heimatmuseen ist immer wieder auch ein Anschlag gebracht worden, naja, das ist so eine Art rückwärtsgewandte Bewegung. Man will irgendwie festhalten am Hergebrachten. Die Welt verändert sich so rasch und deswegen will man sich an der Vergangenheit festhalten und die irgendwie lebendig halten.
Greta Civis: Nostalgie, so das Gefühl?
Hauke Kutscher: Ja, das ist so das eine, kann man sagen. Wird oft auch gesagt, um diese Museen so ein bisschen, ja, man guckt die dann schief an. Gibt es auch in einer akademisch theoretisierten Form, wo gesagt wird, ja, es gibt in den 80er Jahren prominent die sogenannte Kompensationstheorie, die eben sagt, ja, also die Welt verändert sich so schnell und die Menschen müssen dann irgendetwas festhalten. Deswegen gibt es jetzt so eine Welle, wir musealisieren alles und alles kommt ins Museum und damit steht die Zeit irgendwie still. Und da haben wir dann den Anker, der uns gegen sozusagen diese schnellen Bewegungen ja irgendwie schützt, wo wir sozusagen Zuflucht finden können.
Und dieses Wort Heimatstube hat das ja auch so ein bisschen, so eine Stube, die gemütlich ist, wo ich mit Gleichgesinnten mich vielleicht treffe. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Aspekt bei diesen Heimatstuben. Die sind halt häufig auch schon immer angelegt auf so eine gewisse Geselligkeit. Also es geht nicht nur darum, man sammelt und zeigt es und hat dann ein Publikum, sondern es geht auch darum, dass sich dort Menschen treffen. Und das ist so diese Form der Stube gibt das so ein bisschen her. Das ist ja bis heute so. Man hat irgendwie Möbel, die man ausstellt, aber auf denen man dann auch Platz nimmt. Und das ist etwas, was auch sehr besonders ist da.
Das ist aber natürlich auch, wenn ich nochmal auf diese sogenannte Kompensationstheorie zurückkomme, das ist natürlich auch immer kritisch hinterfragt worden, ob das wirklich so ist. Die sind stark kritisiert worden, weil die Museen insgesamt natürlich sagen, naja, wir sind eigentlich, so wie es in dieser Museumsdefinition heißt, sie sollen die Museen stehen im Dienste der Gesellschaft und ihrer Entwicklung und nicht im Dienste des gesellschaftlichen Stillstandes oder der Rückwärtsrolle. Also das Selbstverständis von Museen ist dann h eben auch ein anderes und deswegen ist das auch glaube ich auch mit guten Gründen auch immer ein bisschen in Frage gestellt worden, ob das so hinkommt. Aber natürlich, das Motiv, eine Welt zu bewahren, die so ein bisschen verschwindet und untergeht, ist sicherlich auch ein Teil davon.
Greta Civis: Und wenn man sagt, zum einen Bestandteil von einer Museumsdefinition ist, eine gesellschaftliche Funktion zu erfüllen, beziehungsweise auch gesellschaftliche Entwicklungen zu begleiten, und das Heimatstuben ja eher im Selbstanspruch vielleicht nicht haben, zumindest nicht die Begleitung von Entwicklung, sondern eher ein Freezing. Dann auch zum Beispiel das Erforschen eigentlich immer eine Aufgabe von Museen ist, das aber natürlich ehrenamtliche Museen auch nicht oder nur ganz rudimentär leisten können, dann aber fast alle diese ehrenamtlichen Heimatmuseen, Heimatstuben auch eine ganz wichtige soziale Funktion vor Ort haben, dadurch, dass sie eigentlich immer einen Verein haben. Also Nieheim, haben ja Herr Rascher und Herr Thumm gesagt, sie haben 130 Mitglieder, davon ist rund die Hälfte auch wirklich aktiv dabei, wenn irgendwas ansteht. Also da kommen ja schon mal ganz schön viele Leute zusammen zum Waffelbacken. Und da gibt es auch Konzerte und Kabarett und sowas.
Das ist doch dann eigentlich, gerade in kleineren Orten, ist es dann so eine zentrale Kulturinstitution, die multifunktional ist oder mehrfach funktional.
Hauke Kutscher: Ja, würde ich auf jeden Fall so sehen. Und das hat auch sozusagen, glaube ich, steht auch am Anfang dieser Bewegung, auch schon um 1900. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Funktion in diesen Orten, die ja auch einhergeht. Also es ist ja nicht nur, ich kann das aufsuchen und sozusagen konsumieren, sondern ich kann da auch mitmachen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, glaube ich, an diesen Häusern.
Ich bin da eingeladen, mich in so einem Verein zu engagieren. Und das, glaube ich, ist ein ganz großer Wert und auch ein besonderes Merkmal dieses Museumstyps, der Heimatmuseen oder der Heimatstuben. Das ist quasi die Geschäftsgrundlage. Also viele, ich sag mal, in Anführungsstrichen professionell geführte Museen, deswegen in Anführungsstrichen, weil durchaus manche dieser Heimatmuseen in verschiedenen Aspekten durchaus professionell auch arbeiten, mit all den Problemen, die das hat. Aber manche der, ich sag mal, kommunal getragene Museen, die also durch die öffentliche Hand finanziert sind, die bemühen sich jetzt darum, so ein anderes Verhältnis auch zu Besucherinnen und Besuchern zu haben, sie stärker zu integrieren, sie zu Partizipation aufzufordern.
Also das ist sozusagen, wo man früher vielleicht so ein Museum, die sind die Professionals, die sind die Museumswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und wir sagen jetzt dem Publikum, was wir hier vermitteln wollen. Und jetzt versucht man mehr auf Partizipation zu setzen, die Leute mehr auf andere Art und Weise anzusprechen und ins Museum zu bekommen. Das ist so für die öffentlich getragenen Museen ist es jetzt gerade ein Riesenthema. Bei den Heimatstuben, Heimatmuseen ist es von vornherein die Geschäftsgrundlage. Also ohne das funktioniert das ja gar nicht.
Greta Civis: Vor ein paar Jahren kam auch dieser Begriff des dritten Ortes so ganz stark auf. Da habe ich mir ja auch gefragt, ob das nicht eigentlich auch so die Kernbeschreibung von solchen Einrichtungen ist. So alles Mögliche erfüllt wird, auch ein Zusammenkommen.
Hauke Kutscher: Ja, also ich glaube, das ist viel diskutiert worden, dieses Thema dritter Ort. Und ich glaube, ja, das hat viele Merkmale davon. Das meint ja einen Ort, also der dritte Ort neben dem Ort, wo ich erstens lebe, zweitens arbeite und dann gibt es einen dritten Ort, wo ich eben was anderes tue. Und das ist möglicherweise so ein Heimatmuseum, wo ich vielleicht zum Beispiel Menschen treffe, die ich in anderen Kontexten eben sonst nicht treffen würde. Und wo vielleicht auch sowas wie soziale Unterschiede plötzlich ein bisschen nivelliert werden.
Also wenn dann, du hast gesagt, da ist dann vielleicht der örtliche Studienrat, der da so ein Museum macht und dann gibt es irgendwie Leute aus ganz anderen beruflichen und sozialen Kontexten und die würden sich privat vielleicht so gar nicht begegnen, aber an diesem Ort begegnen sie sich und da passiert eben was Neues und eine neue Qualität. Und das, glaube ich, ist tatsächlich eine besondere Qualität dieser Häuser.
Greta Civis: Und Dennis, Stichwort Partizipation. Das nimmt im Sackmuseum tatsächlich auch wieder sehr lustige Formen an. Also Herr Rascher hat auch in der Führung erzählt, er geht manchmal durchs Haus und dann stehen da neue Sachen.
Hauke Kutscher: Ja.
Greta Civis: Das beschreibt sie ein bisschen genau, das Spannungsverhältnis. Sie hat mir dann auch einen Airbag gezeigt, der dann da eines Tages stand. der hatte nach Meinung von irgendjemandem wohl gefehlt in der Sammlung. Ich habe da gefragt, kam der bei Ihnen aus dem Vereinskontext? Er sagt, nein, der stand da einfach. Und daneben hing dann aber ein Erklärungszettel.
Also der Heimatverein hat den Impuls dann aufgegriffen und den Airbag tatsächlich in die Ausstellung oder Sammlung integriert und selber noch in der Erklärung zugepinnt. Das ist übrigens ein Airbag, so sieht das auch aus. Ist auch interessant, ich hatte noch nie einen Airbag so gesehen. Aber da habe ich mich auch gefragt, ist das noch Partizipation?
Hauke Kutscher: Ja, naja, es ist nicht unproblematisch, aber erst mal ja besser, als wenn was wegkäme aus der Sammlung. Und ja, ist trotzdem natürlich nicht unproblematisch, weil ja auch die Frage ist, wie viele Objekte übernimmt man da? Das ist ja für das Museum, da sind wir bei der Frage auch der fachlichen Standards. Wenn etwas Teil der Sammlung ist, dann hat man auch eine Verantwortung dafür und dann muss man das, ja, eine der Funktionen ist bewahren. Das heißt, man muss es unterbringen, das braucht Raum und Platz und man muss vielleicht auch für gute konservatorische Bedingungen sorgen. Das heißt, wenn da Leute sozusagen einfach ihre Sachen so hinbringen und anonym das dann dort abladen, ist das auch problematisch.
Ist auch problematisch, wem gehört das denn dann? Also es gibt ja keine richtige Schenkung oder so, also da sind viele Sachen drin. Aber klar, sowas kommt vor und ich habe früher im Freilichtmuseum gearbeitet, da passiert das halt auch sehr häufig, dass Menschen eben was bringen. Ja, das ist so dieser, oft dieser Gedanke, also da ist es ja mit dem Airbag total nachvollziehbar, natürlich muss der Airbag ins Sackmuseum, das ist eben auch ein Beutel oder ein Sack, aber es ist, bei den Freiheitlichen Museen ist es halt häufig so, sieht man am Monatsende klingelt das Telefon, weil es wird der Haushalt aufgelöst, die Eltern sind verstorben, die haben aber noch so schöne alte Sachen, einen sogenannten Bauernschrank, ob der dann historisch alt ist oder nicht, ist eine andere Frage. und man findet, es ist zu schade, um es sozusagen auf den Müll zu geben. Also fragt man doch das Museum.
Und die Museen haben natürlich über Jahre und Jahrzehnte zum Teil eben gesammelt, die großen Freilichtmuseum zum Beispiel. Und dann muss man das ablehnen. Und manchmal ist dann die Reaktion auch von Menschen darauf zu sagen, ja, das habe ich schon öfter erfahren. Die Museen nehmen das nicht, also lade ich es einfach ab. Und es ist doch so wichtig, dass das erhalten bleibt. Also das passiert natürlich schon. Also bei der, ich glaube, aber tatsächlich natürlich ist die Frage, wo kommt die Sammlung her und wer bringt da was, wer hat da Interesse? Das zeigt ja auch ein ganz großes Interesse daran.
Da muss man ja erstmal drüber nachdenken. Ich habe irgendwie einen Airbag, also bei mir ist der im Auto verbaut, der ist noch nicht ausgelöst. Ich weiß nicht, vielleicht hat man eine Autowerkstatt und dann liegt so ein Ding rum. Da muss man natürlich irgendwie sagen, auf die Idee kommen, Mensch, das wäre doch was für ein Sackmuseum. So was haben die ja noch gar nicht. Und ich finde das schon ein Punkt, dass man mit den Menschen einfach auf diese Art und Weise auch in Kontakt ist. Also es ist nicht so schön, wenn es so einfach abgeladen wird. Es wäre schöner, darüber zu sprechen. Wo kommt das Objekt her? Warum ist es wichtig? Oft ist es ja den Menschen persönlich wichtig. Sie haben irgendetwas, was sie damit verbinden, was sie noch vermitteln wollen. Das ist ja für das Museum wichtig, um das zu dokumentieren, um das auch vielleicht weitertragen zu können. Sonst weiß man über die Dinge nichts. Also das wäre auf jeden Fall immer zu wünschen. Aber es ist eben auch eine Form der Beteiligung von Menschen an dieser Museumsarbeit, sich für diese Sammlung zu engagieren, wenn man so will.
Greta Civis: Und diese persönlichen Geschichten, das ist mir auch viel begegnet im Sackmuseum. Also da gab es irgendwie Kostüme, die aus Säcken geschneidert wurden. Es gab eine Postkarte mit einem kleinen Salzsack aus Salt Lake City, der in der Familie weitergereicht wurde, solche Sachen. Da werden zu Dingen, da wird zu Dingen eine emotionale Bindung aufgebaut, die eigentlich eine emotionale Bindung zu anderen Leuten beschreibt.
In der Vorbereitung hatten wir uns ja auch unterhalten über den Begriff des „Wilden Museums“ von Angela Janelli, den fanden wir beide ganz spannend weil dann das ist ein anderer Ansatz auf diese Heimatmuseen zu schauen und zwar weniger vom Defizitären her, dass das keine richtigen Museen sind, was die alles nicht können, sondern Janelli macht in Analogie zu Lévi-Struß „Wildem Denken“, spricht sie vom „Wilden Museum“ und benutzt auch dessen Bild vom Ingenieur, das wäre also der hauptamtliche, fachlich voll ausgebildete, die hauptamtliche, fachlich voll ausgebildete Museumsmitarbeiterin versus des Ehrenamtlers im Museum, das wäre dann der Bricoleur oder im deutsch übersetzt der Bastler, der also mein Eindruck war so auch wirklich lustbetont mit den Dingen agiert und eher noch mehr schafft.
Während die Ingenieurin da analytisch durchgeht, eher reduziert, eher weniger Objekte mit einem stärkeren Punkt präsentiert. Und der Bricoleur erfreut sich auch an der Masse. Und auch das begegnet einem im Sackmuseum, man kommt dann in diesen Spitzboden und da hängen auf Kleiderstangen an Kleiderhaken Säcke aufgereiht. Ich habe in einem anderen Podcast den verlinken wir das ist „BITTE NICHT ANFASSEN“ da wird die Zahl von 700 Säcken genannt die die haben und die werden alle gezeigt.
Und das finde ich zum einen ganz spannend, also wirklich so auch so eine Lust und so eine Freude an vielen und ich habe mich gefragt, das Sackmuseum ist ja tatsächlich ein bisschen bekannt, also ich würde sagen Kenner Kennens, so als ein Beispiel für ein lustiges Heimatmuseum, was auch selbstironisch sein kann. Und was es damit geschafft hat, in einer Wetten-Das-Sammlung erwähnt zu werden von Böhmermann, ich muss allerdings sagen, recht despektierlich war das, glaube ich, gemeint. Also er hat wohl gesagt, ich muss gestehen, das Original konnte ich nicht finden, aber er hat wohl gesagt, der deutsche Film sei lustig und aufregend wie ein Besuch im Sackmuseum.
Um und bei, also eher als ein Beispiel für was langweiliges, wobei ja dieses Splienige spricht viele Leute an. Und dann gibt es noch einen YouTube-Clip von Hirschi Jasmo Löffelbein, wo es auch immer ist, ich will ins Sackmuseum Nieheim.
Ich fahre nur nach Nieheim, Westfalen, ins Sackmuseum Nieheim. Im Sackmuseum Nieheim. Oder ich will nie heim.
Also das spricht schon auch Leute an aus einer Generation, die eigentlich nicht so ganz typisch oder aus einem Umfeld, was man nicht so ganz typisch im Heimatverein verorten würde. Und ob das vielleicht der Weg ist, wie das funktioniert?
Hauke Kutscher: Ja, also ich glaube, jeder schmunzelt ja so ein bisschen. Wenn man sagt, ich bin ja jetzt, wir haben im Museumsamt so ein Gebietsprinzip und ich bin der Referent für das östliche Westfalen, da liegt Nieheim jetzt auch. Also wenn mich dann immer jemand fragt, so tolle Museen, hast du ja am Anfang auch gefragt und hat man natürlich mehr im Kopf, aber Sackmuseum Nieheim kommt immer und kommt immer gut an, weil jeder sofort sagt, ja, was ist das denn? Hat so was Kurioses so ein bisschen.
Es gibt, glaube ich, auch so einen Dumont-Reiseführer zu Kuriosen, Sammlungen und Museen und da sind die auch prominent drin, neben Paris, New York, Nieheim so. Und das, natürlich leben die auch ein bisschen davon und das ist, finde ich, auch ganz, ganz klasse. Ist übrigens ein Teil auch, diese neue überarbeitete Museumsdefinition, da ist in den letzten Jahren viel diskutiert worden, Museen sollen auch Freude bereiten. Es ist sozusagen nicht mehr die, nicht mehr nur die strenge Bildungsveranstaltung, ja, also das Vitrinenmuseum, bitte nichts anfassen, sondern sie sollen auch Orte sein, an denen man sich erholen kann, an denen man eben auch Freude empfinden kann und so.
Und das, glaube ich, auch, geht auch Hand in Hand. Ich glaube, das ist natürlich auch ein Spaß. Mir geht es halt so, naja, Sackmuseum, wenn ich da so positiv gestimmt reingehe, dann ist das natürlich wie so ein Wimmelbild. Also was gibt es noch alles zu entdecken? Da kann man Spaß dran haben. In anderen Kontexten, wenn ich in eine Sammlung gehe, ich möchte etwas in einem Landesmuseum über die Landesherrschaft erfahren und wenn ich dann mit zu vielen Objekten konfrontiert bin, die mir nichts sagen, bin ich schnell überfordert. Das hängt natürlich immer so davon ab, wie komme ich in so einen Ort rein? Wie besuche ich es? Was ist so meine innere Haltung auch dazu?
Und deswegen ist das vielleicht nicht die Blaupause für alles. Und es ist so dieses Überbordende, das ist mal eben schön und man hat Freude daran, mal ist es auch eine Überforderung. Das muss man auch sehen. Aber ich glaube, in Nieheim funktioniert das ganz gut.
Greta Civis: Wir sind da an dem Thema langgekommen, dass die Heimatvereine und auch Heimatmuseen, ich glaube, das Ehrenamt generell ziemlich mit Überalterung zu tun hat. Und wir haben in unseren Vorgesprächen auch gedacht, es wird auch einfach ein paar dann irgendwann nicht mehr geben. Dieser Weg der Spezialisierung, denkst du, das ist ein guter Weg, den noch mehr Häuser gehen werden und der auch zu einem Erhalt beiträgt? Oder was wäre so eine Möglichkeit für, oder ist es überhaupt angesagt, oder ist vielleicht die Zeit der Heimatstuben auch vorbei im Großen und Ganzen? Es war ein Bedürfnis einer bestimmten Zeit und jetzt gibt es vielleicht andere Bedürfnisse. Wenn wir mal versuchen, in die Zukunft zu schauen, was denkst du, wie wird es werden?
Hauke Kutscher: Ja, ich glaube tatsächlich, dass das leider so ist, dass einige dieser Orte eben schließen werden. Das haben wir auch schon erlebt. Bei uns auch ein Thema für diese Museumsstatistik. Die Museen melden sich ja nicht bei uns an oder ab, aber wir kriegen natürlich auch mit, dass Häuser auch schließen. Und das hängt eben, du hast es erwähnt, oft mit demografischen Faktoren zusammen, die Vereine überaltern und es ist dann schwierig, Nachwuchs zu bekommen. Also jüngere Ehrenamtliche, die sagen, wir wollen das weiterführen und das ist eine Sache, die wir auch stärker auch begleiten müssen, was passiert mit diesen Sammlungen.
Es gibt halt eben, ja, neben dem Sackmuseum Nieheim gibt es natürlich andere Beispiele auch von solchen Heimatvereinen, die so ein Museum führen. Und ich würde dir da recht geben, es ist nicht selten so, dass Museen, die so ein Alleinstellungsmerkmal rausgearbeitet haben, also etwas, was ich nicht an jeder Ecke ähnlich sehen kann, dass die dann doch noch stärker am Laufen sind und auch mehr Leute motivieren, sich da zu engagieren. Also ich denke zum Beispiel, in meinem Gebiet gibt es ganz andere Ecke, ganz im Norden Petershagen, an der Weser gibt es das Heringsfängermuseum. Und da denkt man erstmal, ja, Heringe in der Weser fangen irgendwie nicht. Warum eigentlich? Ja, und das Thema ist halt Wanderarbeit. Das sind Saisonarbeiter, die dann eben in die Niederlande zum Heringsfang gegangen sind. und das spielt für den Ort Petershagen-Heimsen dann eine große Rolle.
Aber ist natürlich irgendwie erstmal, sag ich mal, auch für Besucherinnen und Besucher, die da vielleicht als Touristen unterwegs sind in der Gegend, Fahrradtouristen zum Beispiel, die dann davon hören und sagen, ja, das ist ja ein spannendes Thema. Es ist was anderes, als wenn da heißt, ja, hier ist das Dorfmuseum zu einem Dorf so und so und die sagen, ja, ja, wir haben auch so ein Dorfmuseum und wir wissen schon, was uns da erwartet. Also das ist auf jeden Fall etwas, so eine Spezialisierung oder eben ein Alleinstellungsmerkmal, ein Thema zu finden, einen roten Faden, einen besonderen Zugriff.
Und das ist natürlich etwas, wo wir im Museumsamt auch in der Beratung halt unterstützen. Aber es ist auch nicht einfach. Das bedeutet ja zum Beispiel auch in den Vereinen, dass diejenigen, die das vielleicht über 10, 20 Jahre gemacht haben, dass Leute dann auch irgendwann mal sagen müssen, wir lassen jetzt mal los und lassen mal andere Leute etwas anderes machen. Und das fällt auch nicht leicht. Das ist ja schon in der professionellen Umgebung. Das kennst du auch. Irgendwie Chefin, Chefin geht und dann ist die Frage, kann man so richtig loslassen von dem ehemaligen Job? Muss man jetzt alles noch irgendwie dann hinterfragen und so? Und das ist, glaube ich, gerade bei den Heimatvereinen, die das ja mit viel Herzblut machen.
Ich finde übrigens bei dem Buch von Frau, wie heißt sie? Janillei?
Greta Civis: Janelli.
Hauke Kutscher: Janelli, über die wilden Museen. Da ist im Untertitel der Begriff Amateur-Museum. Und das finde ich eigentlich einen ganz schönen Ausdruck, Amateur. Also das klingt für uns ja immer so, ja, das sind eben die Nicht-Profis. Aber Amateur sind ja erst mal Leute, die etwas aus Liebe zur Sache, mit Herzblut betreiben. Und das ist, finde ich, auch ein wichtiger Faktor. Es ist eben kein Beruf, sondern die machen das mit hohem Engagement. Aber es ist dann eben tatsächlich schwierig zu sagen, ich lasse jetzt mal los. und jetzt muss ich mal was ganz verändern, damit es überhaupt in die Zukunft gehen kann. Das ist kein einfacher Prozess.
Da versuchen wir zu unterstützen, so gut es dann geht und eben auch inhaltlich zu beraten. Wie kann man so eine Neukonzeption vielleicht beginnen? Was muss man da inhaltlich ändern? Was muss man in der Art und Weise, wie man etwas erzählt, ändern? Auch so Fragen wie, was für neue Medien sind sinnvoll oder vielleicht auch nicht sinnvoll, wenn wir an Digitalisierung denken. Was kann so ein Verein davon profitieren? Wo es aber vielleicht dann auch, ja man muss auch sehen, was sind eigentlich die Ressourcen, die wir haben, was können wir leisten und so. Das ist so ein bisschen unser Job.
Greta Civis: Ich habe die Frage auch in Nieheim gestellt und das sagt Michael Rasche dazu.
Michael Rasche: Ich glaube, es ist grundsätzlich gut, wenn man sich irgendwo spezialisiert, wenn man irgendwo ein besonderes Wissen hat oder besondere Geschichten erzählen kann zu irgendeinem Thema, wo sich ja einer so komprimiert noch nie mit auseinandergesetzt hat. Also für hier sehe ich, ist es der richtige Weg. Das glaube ich schon, dass das auch gut ist, dass die Städte das herausarbeiten oder die Museen das herausarbeiten, was die Stadt ausmacht.
Greta Civis: Ich bin jedenfalls gespannt, wie es weitergeht mit diesen wilden Sammlungen von Dingen, die zu Menschen sprechen und die Menschen miteinander sprechen lassen. Dir, Hauke, danke ich sehr für das Gespräch, hat mich sehr gefreut und nochmal ganz herzlichen Dank und Grüße nach Nieheim.
Hauke Kutscher: Vielen Dank, ich fand es auch super.
Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt vom Nachdenken über das Museum an und für sich, dann empfiehlt sich neben einem Museumsbesuch beispielsweise ein Blick auf die Seiten der ICOM oder des Deutschen Museumsbundes. Das Buch von Angela Janelli, Wilde Museen, schreiben wir mit ausführlicher Zitation natürlich auch in die Folgenbeschreibung. Außerdem verlinken wir den Podcast „BITTE NICHT ANFASSEN“, in dem die Hosts wechselseitig Museen besuchen und sich davon erzählen.
Regionalgeschichte auf die Ohren „Untold Stories - Westfalens verborgene Geschichten erzähle[n]“ dieser podcast ist eine Co-produktion des LWL-Medienzentrums für Westfalen und des LWL-Instituts für westfälische Regionalgeschichte. Das Projekt wird von der LWL-Kulturstiftung im Rahmen des Kulturprogramms zum Jubiläumsjahr 2025, 1250 Jahre Westfalen, gefördert. Schirmherr des Kulturprogramms ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.