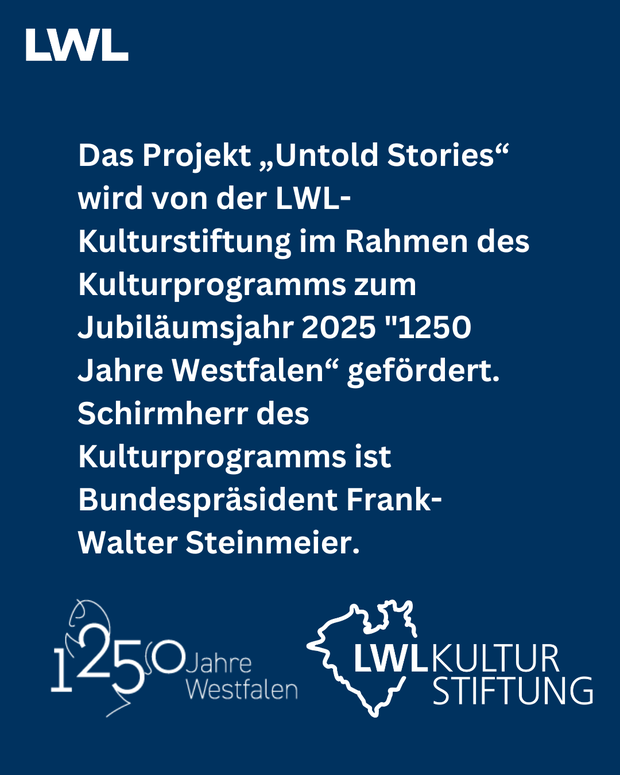Transkript
Regionalgeschichte auf die Ohren
Greta Civis: „Die Zone“, „Drüben“, „der Osten“ - das sind nur einige der zahlreichen Namen, die zwischen 1945 und 1990 in der Bundesrepublik für das andere Deutschland, die DDR, benutzt wurden. Dort änderte sich das Leben ab 1989-90 immens. Die Berliner Mauer wurde geöffnet, der Kalte Krieg endete.
Richtung Osten schwappten nicht nur neue Waren, Reisefreiheit, demokratische Wahlen und überhaupt mehr Wahlmöglichkeiten, sondern auch Arbeitslosigkeit, Verunsicherung und zunehmend Frustration. All das gehört zur kollektiven Erzählung in Deutschland. Doch wie war es eigentlich im Westen? Vor allem, wie war es hier in Westfalen und in Lippe? Wie wirkte sich der Kalte Krieg auf das Leben der Menschen aus und wie wurde das Ende des Systemkonflikts hier bearbeitet?
Das bespreche ich heute mit
Claudia Kemper: Claudia Kemper
Greta Civis: und ich bin Greta Civis.
Kalter Krieg vor der Haustür. Westfalen und Lippe zwischen Ost und West.
Claudia, danke, dass du da bist. Du bist Referentin am LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte und hast da das Referat Neuere und Neueste Geschichte. Das betrifft auch die Zeit des Kalten Krieges ganz zentral. Westfalen hat ja keine direkte Grenze mit der vormaligen DDR, anders als zum Beispiel Niedersachsen oder Bayern. Das ist ja wirklich ein sehr westliches Bundesland. Dennoch beeinflusste der Kalte Krieg ja das Leben der Menschen vor Ort. Wie genau betraf der Konflikt Westfalen?
Claudia Kemper: Ja, man würde denken, dass in Westfalen eigentlich gar nicht viel spürbar gewesen ist vom Kalten Krieg, weil man relativ weit weg war vom Zonenrandbezirk, von den Grenzübergängen und überhaupt von dem unmittelbaren Geschehen vielleicht. Aber wie in allen Regionen Deutschlands, beziehungsweise der Bundesrepublik, der damaligen, war der Kalte Krieg präsent, auch sehr präsent, wenn man es denn wissen wollte. Es gab, würde ich mal sagen, so zwei Ebenen, auf denen man das spüren konnte.
Zum einen ganz materiell das, was vor Ort geschah und da geschah auch in Westfalen einiges. Es gab Waffenlager, es gab eine deutlich hohe Präsenz von Militär hier vor Ort, es gab Bunker, es gab natürlich auch für jeden jungen Mann damals den Wehrdienst, der irgendwann entschieden werden musste.
Die Waffenlager waren in Westfalen relativ verteilt in den Kreisen. Es gab ein Sondermunitionslager, so hießen die immer, wenn dort Nuklearwaffen gelagert worden sind, in Dülmen, das ist im Kreis Coesfeld. Es gab was in Ostbevern, das ist hier bei Münster, in Werl, bei Hamm oder in Bührenkreis Paderborn oder auch in Uthuisen bei Rheine. Das heißt, überall verteilt in Westfalen gab es nukleare Waffenlagerungen.
Und schon an diesen Waffenlagern kann man sehen, wie ambivalent der Konflikt gewesen ist. Weil einerseits war klar, dass Atomwaffen gelagert werden auf dem Gebiet der Bundesrepublik und zwar auch verteilt auf dem ganzen Gebiet. Und andererseits gab es eine ganz große Geheimhaltung darum, eine ganz große Geheimniskrämerei. Es waren oft unscheinbare Orte und dennoch waren sie natürlich dadurch, dass sie sehr geschützt und Sicherheitsgebiet waren, sehr präsent für die lokale Bevölkerung. Alle wussten es und trotzdem sollte man nicht so genau wissen.
Das Gleiche gilt für die Bunker und da ist es vielleicht noch interessanter, wenn wir über Bunker sprechen, wie ambivalent während des Kalten Krieges die Situation gewesen ist. Einerseits gab es eine ganz große Klarheit darüber, dass man sich schützen muss im Falle eines Atomkrieges. Das war sehr präsent. Und vor allen Dingen ab den 1960er-Jahren war das sehr präsent in der Politik und auch in der Bevölkerung, dass das eine Gefahr ist, eine Bedrohung. Und mit der zunehmenden Aufrüstung ab Ende der 1970er war das wieder übermäßig präsent, dass es eine reale Gefahr gibt, dass man einen Atomschlag erleben könnte. Und dass man sich davor schützen müsste in irgendeiner Form, wenn es denn überhaupt möglich ist. Und Bunker waren natürlich da eine ganz wichtige Sache.
Die meisten stammten aus dem Zweiten Weltkrieg, wenn sie denn noch intakt waren. Und es gab dann einige Neubauten auch ab den 1960er-Jahren. Und auch in Westfalen gab es einige Neubauten. Den Fernmeldebunker in Wiedenbrück oder im Kreis Siegen den Luftverteidigungsbunker. Nun ist aber das völlig klar gewesen und offensichtlich gewesen, dass die Kapazitäten solcher Bunker nicht ausreichten, um auch nur ansatzweise die Bevölkerung zu schützen, geschweige denn, was die Vorwarnzeiten angeht. Das war ein offenes Geheimnis. Darüber wurde aber trotzdem nicht explizit gesprochen, sondern im Gegenteil; es war der Zivilschutz während des Kalten Krieges kommunizierte schon so, dass die Bunker eine Option sind, neben dem Selbstschutz, dass man einen Keller haben sollte, dass man sich bevorraten sollte.
Aber in einem Gebiet in einer Region wie Westfalen, aber auch in anderen Regionen der Bundesrepublik, war das bei der Bevölkerung zu keiner Zeit des Kalten Krieges besonders populär. Also wenn man in die Quellen reinschaut aus der Zeit, dann ist es irgendwie völlig klar, dass die meisten Leute sich nicht besonders darum gekümmert haben, jetzt sich selbst zu schützen oder zu bevorraten. Also das, was wir derzeit erleben an Prepper-Kultur, das war sogar in den Hochzeiten des Kalten Krieges nicht so ausgebildet.
Aber gleichzeitig gab es eine große Angst. Und die war auch in Westfalen sehr präsent. Und die Friedensbewegung, die sich ab den frühen 80er-Jahren dann gebildet hat und auch in Westfalen sehr aktiv gewesen ist, Ist ja ein Zeichen dafür, dass das Bewusstsein dafür, dass man unter einer ständigen Bedrohung steht, und auch das Gebiet in Westfalen, das jetzt eben nicht an der Grenze liegt oder wo kein Stationierungsort neuer Atomwaffen vorgesehen war, trotzdem natürlich gefährdet ist, weil ein Atomschlag natürlich immense Auswirkungen hat.
Und das macht vielleicht insgesamt so deutlich, wie eben ambivalent der Kalte Krieg gewesen ist. und auch sich in einem relativ unbeteiligten Region wie Westfalen durchaus niedergeschlagen hat.
Greta Civis: Das sind ganz viele verschiedene Ebenen. Das ist zum einen die Ebene Zivilschutz. Da hätte ich hier einen Ton vom Bundesamt für Zivilschutz aus den 60ern.
Das Bundesgebiet ist in zehn Warngebiete eingeteilt, die weitgehend mit den Ländergrenzen identisch sind. Von den Verbindungsstellen bei der NATO werden die zehn Warnämter ständig über die Luftlage informiert. Im Ernstfall alarmieren die Warnämter die Bevölkerung über Rundfunk und über die Sirenen. Ein auf- und abschwellender Heulton von einer Minute Dauer bedeutet zum Beispiel Luftalarm. Entwarnung, ein gleichbleibender Dauerton von einer Minute.
Das heißt, auf Bundesebene wurden die Leute durchaus auf den Krieg vorbereitet, auch proaktiv vorbereitet, indem eben solche Aufklärungsfilme auch gedreht wurden. Also es ist aus einem Aufklärungsfilm des Bundesamtes für Zivilschutz. Aber die Leute vor Ort haben sich davon nicht so verrückt machen lassen, oder? Es gibt die Doku Achtung ABC-Alarm vom LWL-Medienzentrum für Westfalen. Da sind mehrere dieser erwähnten jungen Männer, die Wehrdienst leisten mussten oder auch Zeitsoldaten waren, interviewt worden. Und da sagte zum Beispiel Rainer Wick, ehemaliger Zeitsoldat, aber eben auch Einwohner der Stadt Wittgenstein, mit Sicht auf den Bunker Erich. Das war, ich glaube, ein Flakabwehrbunker oder ein Kommunikationsbunker.
Claudia Kemper: Luftverteidigung, also das war einer, von dem aus dann eben auch angreifende Raketen abgeschossen werden konnten.
Greta Civis:
Und der sagt eigentlich sehr lakonisch über die Anwesenheit des Bunkers.
Ich, als Wittgensteiner Einwohner, bin mit diesen Gegebenheiten groß geworden. Wir haben tagtäglich den Hügel des Bunkers oder die Funksende und Funkempfangsanlage gesehen. Und wir haben auch gewusst, dass wenn es zu einem Krieg kommen würde, wir es sicherlich Ziel sein würden. Für uns Wittgensteiner ist der Bunker auch ein wichtiger Arbeitgeber gewesen. Mein Vater und mein Schwiegervater waren beide hier Wachleute am Bunker. Meine Schwägerin zum Beispiel war tagtäglich hier im Bunker als Sekretärin eingesetzt.
Also Familienleben und Bunker, Teil der Landschaft und einfach Normalität im drohenden Krieg?
Claudia Kemper: Ja ich glaube das beschreibt es ganz schön, dass es eine gewisse Selbstverständlichkeit gab in der Wahrnehmung dieser militärischen Präsenz die im Kalten Krieg auf dem ganzen Bundesgebiet war in allen Regionen.
Und das Besondere der Nuklearstrategie ist ja gewesen dass vor allen Dingen ab den 60er Jahren die regionalen Stützpunkte immer wichtiger wurden. Das heißt, einerseits wurden immer mehr in die Provinz hinein stationiert. Das war ja auch Ende der 70er Jahre ein großes Thema. Und andererseits war klar, dass die Nuklearstrategien immer regionalisierter wurden, das heißt immer kleinteiliger.
Am Anfang des Kalten Krieges gab es noch die Nuklearstrategie massive, komplette Vernichtung. Und mit Flexible Response ab Ende der 60er Jahre war klar, dass sich die Ziele immer genauer, immer regionalisierter ausgesucht wurden. Und darauf wurde reagiert mit einer entsprechenden Verteilung auch der Stationierung.
Und die stationierten Waffen, die stationierten Truppen der NATO-Mächte, das waren ja nicht nur USA und Großbritannien, sondern auch französische, belgische, vor allen Dingen in Westfalen auch belgische Truppen, war eine ganz große Selbstverständlichkeit in allen Gebieten der Bundesrepublik. Und auch die Waffenlager waren eine gewisse Selbstverständlichkeit, das gehörte so zum Leben dazu.
Es gab verschiedene Phasen des Kalten Krieges, in denen die Präsenz nochmal problematisiert worden ist und auch die öffentliche Diskussion darüber, was eigentlich ein Atomschlag bedeutet. Tatsächlich so nachhaltig ins Bewusstsein und auch in die Öffentlichkeit getreten ist das erst ab Ende der 1970er Jahre. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist der Kalte Krieg in dieser Zeit dramatisch eskaliert. Es gab eine neue Aufrüstungswelle, vor allen Dingen dann eben in Mitteleuropa, vor allen Dingen in der Bundesrepublik war das geplant. Der NATO-Doppelbeschluss ist natürlich hier der wichtige Begriff.
Greta Civis: Kannst du das kurz ausführen, NATO-Doppelbeschluss?
Claudia Kemper: Der NATO-Doppelbeschluss war eine Reaktion der NATO-Staaten auf eine Modernisierungswelle der Mittelstreckenraketen auf sowjetischer Seite. Die SS-20-Raketen sind so modernisiert worden, dass sie eine kürzere Vorwarnzeit, einen schnelleren Angriff möglich machten für die Sowjetunion. Und die NATO-Staaten reagierten, indem sie ganz neue Mittelstreckenraketen in Europa stationieren wollten. Das war 1979, der Beschluss und bis 1983 wurde verhandelt zwischen der NATO und der Sowjetunion darüber, dass die Sowjetunion ihre Modernisierung zurücknimmt oder auch sich auf Abrüstung einlässt.
Wenn diese Verhandlungen scheitern würden, würde man nachrüsten. Und so gab es so vier Jahre, also bis 1983 haben diese Verhandlungen gedauert, bis sie dann als gescheitert erklärt wurden. Gab es vier Jahre, in denen die mögliche Stationierung neuer Waffen in der Bundesrepublik extrem präsent waren. Und das war die Zeit, in der die Friedensbewegung aktiv geworden ist. Das war die Zeit, in der zum ersten Mal mit einem wahnsinnigen großen, sage ich mal, Bewegung auch darauf reagiert wurde, dass diese atomare Rüstung in der Bundesrepublik so flächendeckend und so intensiv schon ausgebaut war.
Die Friedensbewegung ging natürlich in großen Teilen auch aus der Anti-AKW-Bewegung hervor, wo schon ganz viel Wissen kumuliert war über die Bedeutung von atomarer Nutzung, sowohl zivil als auch militärisch. Was die Friedensbewegung geleistet hat, ist dann eben auch ganz viel Wissen darüber, wo sind eigentlich diese ganzen Waffen? Was bedeutet es, wenn neue Raketen stationiert werden? Was bedeuten eigentlich die unterschiedlichen Waffentypen? Was bedeuten eigentlich Nuklearstrategien? Dass sie dieses Wissen recherchiert haben, weil es gab ja jetzt nicht irgendwie ein Handbuch der Bundesregierung, so ist es, recherchiert haben und unter die Leute gebracht haben.
Im wahrsten Sinne des Wortes, da gab es ja dann eben Flugblätter, Kundgebungen, Informationsveranstaltungen. Und man kann wohl sagen, zwischen 1979 und 83 gab es so eine Welle der Selbstaufklärung. Und das Wissen darüber, was es überhaupt bedeutet, im Kalten Krieg ein nuklear aufgerüsteter Staat zu sein, ist in dieser Zeit überhaupt erst präsent geworden.
Journalismus war natürlich auch ein ganz wichtiger Teil dieser Informationswelle.
1981 veröffentlichte das Magazin Der Stern eine Karte der Bundesrepublik, wo zum ersten Mal für alle sehr präsent die geplanten Stationierungsorte verzeichnet waren, sondern auch sämtliche Waffenlager. Und da wurde, glaube ich, auch der ganz breiten Bevölkerung bewusst und vor Augen geführt, wie nah dran man eigentlich ist an der atomaren Bewaffnung. Und wenn man sich das anguckt, diese Karte, dann kann man sehr schön sehen, wie im Mittelteil der Bundesrepublik von Norden eben auch über Westfalen bis hinunter nach Süden so eine ganz dichte Waffenlagerkonzentration ist. Und vielleicht haben auch in dieser Zeit die meisten Leute überhaupt erst erfahren, dass auch Atomwaffen in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft gelagert sind.
Greta Civis: Also von 1979 bis 83, 84, sagst du, war so die Hochphase der Friedensbewegung, als wirklich dann auch Bewegung, die in die Mitte der Gesellschaft ging, mit unglaublichen Massen. Das ist ganz eindrücklich geschildert, auch in der Doku Achtung ABC-Alarm von Winfried Nachtwei, der in seiner eigenen Biografie das so beschreibt, dass er auch über den NATO-Doppelbeschluss, das Engagement in der Friedensbewegung zu den Grünen und in die Politik kam, dann als Abgeordneter der Grünen.
Ja, es hat da verschiedene Kristallisationspunkte der anwachsenden Friedensbewegung gegeben. Einmal ab 1979 schon eine alljährliche Friedenswoche, wo verschiedene Initiativen und Organisationen zusammengekommen sind, wo man sich auch verständigt hat über eine gemeinsame Sicht dieser für uns neuer wahrgenommenen Friedensbedrohung. Und dann, wichtig, ermutigend, 1981 der Frauenfriedensmarsch von Kopenhagen nach Paris, der auch durch Münster ging. Das war die erste große Demonstration dazu. Und dann 1981, ja, in dem Jahr, die erste große Demonstration im Oktober in Bonn, wo überraschenderweise 300.000 Menschen zusammenkamen. Und das war ein Rückenwind sondergleichen. Man hat gemerkt, boah, wir sind viele, ein Schub. Und das hat dann auch wiederum dazu geführt, dass in vielen Stadtteilen, in verschiedenen Berufsgruppen dann Friedensinitiativen entstanden sind. Also in Münster waren es zig solche Gruppen.
Greta Civis: Ja, wir haben natürlich im Vorgespräch festgestellt, es gibt einige Parallelen zu heute, vielleicht zumindest was so ein persönliches Bedrohungsgefühl, in dem man sich so einrichtet, angeht. Aber es gibt auch ganz gravierende Unterschiede zu heute. 300.000 Leute wüsste ich nicht, dass die gerade irgendwo auf der Straße sind oder so große, auch nur einzelne Friedens-AGs, eigentlich innerhalb eines größeren Verbandes. Haben wir wieder sowas wie eine Blockkonfrontation?
Claudia Kemper: Die Friedensbewegung der 80er Jahre wird in letzter Zeit öfter mal zitiert oder herangezogen, um zu vergleichen, wie die Situation in der Gegenwart ist. Und oftmals wird dann eben gesagt, ja, damals sind so viele Leute auf die Straße gegangen, aber heute gar nicht. Und wo ist denn die Friedensbewegung, da es doch schließlich in Europa auch wieder Krieg gibt? Es gibt Parallelen, es gibt Kontinuitäten vor allen Dingen des Konfliktes, des Ost-West-Konfliktes, die sich bis heute durchziehen. Aber es gibt natürlich gravierende Unterschiede und man kann es nicht miteinander vergleichen.
Der große Unterschied zur Zeit des Kalten Krieges ist mit Sicherheit der, dass es keine Blöcke mehr gibt. Es gibt noch den Militärpakt der NATO, aber es gibt schon gar nicht mehr den Warschauer Pakt und es gibt auch nicht mehr die Sowjetunion. Und Blöcke in dem Sinne, die sich gegenüberstehen, gibt es auch nicht. Es ist schon in den 90er Jahren konstatiert worden, dass wir zunehmend mit hoch asymmetrischen Konflikten zu tun haben in der internationalen Politik bis hin aber auf regionaler Ebene. Asymmetrisch meint, ungleiche Konfliktparteien stehen sich gegenüber und führen auch einen ungleich ausgestatteten Konflikt, ungleich ausgestattet an Instrumenten und an Waffenarsenal.
Nach wie vor gibt es Atomwaffen bei den atomwaffenbesitzenden Staaten, die auch Teil ihrer Militärstrategie sind. Das gilt für Russland genauso wie die USA, das gilt für China, das gilt für Frankreich. Wir haben aber auch nach wie vor Staaten, die Atomwaffen besitzen, die das aber nicht offiziell tun. Indien, Pakistan, Israel. Und wir haben seit den 2000er Jahren zunehmend die Gefahr von schmutzigen Bomben, weil schmutzige Bomben sind eben die, die nicht registriert sind.
Tatsächlich sind alle die Staaten, die Teil des Atomwaffensperrvertrags sind, haben sich verpflichtet, über ihr Atomwaffenarsenal Buch zu führen und auch offen zu legen. Das war Teil der Logik des Kalten Krieges, dass man sich einerseits bis an die Zähne bewaffnet gegenseitig bedrohte und gleichzeitig aber auch immer die Bücher offenlegte und zeigte, was man denn hat. Immer so ein Changieren zwischen vertrauensbildender Maßnahme und Todesdrohung.
Asymmetrisch auch weil natürlich die Instrumente sich l nicht mehr auf konventionelle Waffen oder Nuklearwaffen beschränkten, sondern im hohen Ma in den digitalen Raum in den Cyberspace gewandert sind. Und wie auch die letzten Monate, Jahre zeigen dort auch sehr massiv genutzt werden. Infrastrukturen sind einfach generell davon betroffen, bis hin zu Drohnen, die ferngelenkt werden. Das ist ja auch ein Teil dieser durchaus digitalen Strategie, mit Material dann eben unterfüttert.
Das heißt, die Gegnerschaften sind entsprechend auch nicht mehr ganz eindeutig. Also so kompliziert und komplex der Kalte Krieg gewesen ist, er hatte doch eine gewisse Eindeutigkeit. Die USA als westliche Hauptmacht stehen der Sowjetunion als östliche Hauptmacht gegenüber. Die haben das Sagen, die haben die Hauptmacht und Hauptschlagskraft, was die atomare Vernichtung angeht. Und wenn sich eine Friedensbewegung formiert, dann sind das die beiden Staaten, an die man sich zu wenden hat, um zu fordern, rüstet ab.
Greta Civis: Also klare Forderung, klare Adressaten.
Claudia Kemper: Ganz genau. Und natürlich hat die Friedensbewegung da auch eine Schlagseite gehabt. Die meiste Kritik richtete sich an die USA und nicht an die Sowjetunion und an die eigene westliche Regierung. Da gab es dann das Gegenargument, ja, weil hier können wir was tun, weil Regierungen in Westen werden gewählt. Wir sind das Wahlvolk, wir können Forderungen stellen und entsprechend richten sich unsere Forderungen natürlich an die Bundesregierung, an die US-Regierung und so weiter. Die sollen aufhören, diese Aufrüstung voranzutreiben.
Greta Civis: Und in Ostdeutschland ja auch gleichermaßen mit Schwertern zu Flugschalen.
Claudia Kemper: Durchaus.
Greta Civis: Auch das war ja eine Forderung an die eigene Regierung.
Claudia Kemper: Durchaus. Wobei man sich natürlich in sämtlichen sozialistischen Staaten da schon sehr viel vorsichtiger bewegen musste als alternative Friedensbewegung. Es gab ja eine offizielle Friedensbewegung. Die DDR war ja ein Friedensstaat nach eigener Aussage. Das heißt, man war bis an die Zähne bewaffnet, um den Frieden zu bewahren. Und wenn man dann als alternative Friedensbewegung daherkommt und sagt, es ist aber die falsche Strategie, den Frieden zu bewahren, dann war man schon sofort in der Opposition und natürlich lief man dann Gefahr, entsprechend behandelt zu werden.
Und auch in der Sowjetunion gab es tatsächlich eine Friedensbewegung, eine alternative Friedensbewegung, die aber in der Erinnerung sowohl in Russland als auch insgesamt in der Friedensbewegungsgeschichte kaum eine Rolle spielt, obwohl die unter extrem schwierigen Bedingungen und mit viel Risiko aktiv gewesen sind, um ihre Regierung zu kritisieren, beziehungsweise Informationen zu beschaffen, um in der Bevölkerung zu verbreiten.
Das alles hat große Ähnlichkeiten mit heute, weil auch heute in Russland ein Oppositioneller zu sein ist extrem riskant im Vergleich zu westeuropäischen oder westlichen Staaten auf jeden Fall. Und dennoch ist es schwieriger Adressaten zu finden, wo soll die Forderung hingehen aufzuhören mit der Konfliktsteigerung. Und es gibt extrem unterschiedliche Meinungen, Interpretationen, an welcher Stelle des Konfliktes man eingreifen soll, um ihn zu unterbinden.
Und insofern ist es natürlich auch schwierig für eine Bewegung, sich zu finden zu einer Massenbewegung, weil eine Massenbewegung, so wie sie in den Anfang der 80er Jahren auf der Straße gewesen ist, mit Hunderttausenden, die regelmäßig protestiert haben oder aber auch extrem viele Initiativen übers ganze Land verteilt, die wöchentlich aktiv gewesen sind. Die müssen sich ja in irgendeiner Form auf präzise und allgemein verständliche Forderungen einigen. Und das ist in dem aktuellen Konfliktlage sehr schwierig offensichtlich, da einheitliche Forderungen zu formulieren. Und das war eben Anfang der 80er Jahre mit der klaren Forderung, es soll in der Bundesrepublik keine weitere Stationierung von Atomwaffen geben, Entschuldigung, sehr viel einfacher.
Greta Civis: Wir haben auch einen Ton von einem Generalmajor AD, Robert Bergmann, der auch nochmal ganz klar sagt, auch auf seiner Ebene bei der Bundeswehr wusste man nicht, wo welche Atomwaffen stationiert waren.
Wir stehen hier vor einem der beiden Bunker, die für Atomwaffen vorgesehen waren. Und sehr deutlich wird hier allein die mechanische Sicherung dieser Bunkeranlagen. Drei schwere Stahltore, jedes Tor mit mehreren Schlössern. Faktisch unmöglich hier reinzukommen. Atomare Munition, die hier gelagert worden wäre oder gelagert wurde, hatte die Kaliber, die auch die Geschütze, die in Dülmen stationiert waren, hatten. Und die waren dann auch etwa so einen Meter hoch und hatten dasselbe Kaliber, 155 oder 203 Millimeter. Wir hatten natürlich spezielle Zünder und in der Regel wurden auch die Granaten und die Zünder getrennt gelagert.
Die Atomwaffen waren immer Eigentum der Amerikaner. Und dafür waren auch hier die amerikanischen Soldaten stationiert, um dieses Eigentumsrecht zu gewährleisten. Sie alleine wussten, was in diesen Bunkern liegt und wie viel. Es gehörte zur NATO-Strategie auch heute noch, weder zu bestätigen noch zu dementieren, dass hier Atomwaffen lagern. Die Tatsache, dass hier zwei Bunker sind, hat natürlich auch Sinn, darüber hinweg zu täuschen, dass niemand weiß, was in welchem Bunker liegt, wenn man sich der Waffen hätte bemächtigen wollen.
Greta Civis: Da war also an vielen Orten in der Bundesrepublik atomwaffenfähige Munition. Da waren Atomwaffen an vielen Orten in der Bundesrepublik. Die Bundeswehr selbst wusste eigentlich nicht, was wo genau liegt. Die US-amerikanische Armee hatte da die Oberhoheit. Was geschah damit in den 90ern?
Claudia Kemper: Die meisten sind gleich 1991 abgerüstet worden. Das war ganz klar, dass nach Ende des Kalten Krieges mit der Blockauflösung und auch mit der Beendigung der Notwendigkeit, solche Massen an Nuklearwaffen zu bevorraten, die meisten Lager aufgelöst worden sind.
Und es gibt ja bis heute den Streit darum, dass es eben angeblich noch ein paar weniger Atomwaffen gibt, die im Rahmen der NATO-Vereinbarung von den USA in der Bundesrepublik bevorratet werden. Aber das zeigt noch mal sehr deutlich, dass das Wissen um Atomwaffen eine hoch prekäre Angelegenheit ist und immer Teil der Militärstrategien war und ist. Denn einerseits will man mit Atomwaffen drohen und zeigen, dass man ganz Klar in der Position der Übermacht ist. Dass man jederzeit diese Waffen auch einsetzen könnte. Gleichzeitig muss absolut geheim gehalten werden, in welchem Ausmaß man Atomwaffen besitzt - Wo genau die stationiert sind, was man damit anrichten könnte.
Und in diesem ganz gegensätzlichen Gefüge bewegte man sich im Kalten Krieg die ganze Zeit und das machte eben auch selbst kleinste Munitionslager damit zu einem hochpolitisch und militärisch wichtigen Ort, der eben auch dann im wahrsten Sinne des Wortes umkämpft war, weil es der Friedensbewegung eben darum ging, das Wissen darüber zu recherchieren und die Bevölkerung zu informieren und klar zu machen, was ist da eigentlich.
Greta Civis: Also die Geheimhaltung erfolgt zum einen wahrscheinlich aus militärischen Erwägungen. Die sollten nicht gekappert werden, diese Atomwaffen. Aber tatsächlich auch, um die eigene Bevölkerung vor diesem Wissen zu schützen, denen das Wissen zu ersparen, um es mal freundlich auszudrücken. Oder war das nicht so wichtig?
Claudia Kemper: Die Zivilschutzstrategie des Kalten Krieges ist gewesen, einerseits so viel Informationen an die Bevölkerung zu geben, dass die sich ihrer Gefahr bewusst ist und auch entsprechend Maßnahmen trifft; aber gleichzeitig so wenig Information zu geben, dass sie nicht in Panik gerät.
Und auch da bewegte sich die Politik die ganze Zeit in so einer ganz ambivalenten Situation, lavierte, könnte man heute sagen, so ein bisschen hin und her. Einerseits immer auch Druck zu machen, dass man sich in Gefahr befände. Und natürlich auch waren antikommunistische Propaganda oder auch Feindstereotypisierung gehörten da dazu. Und andererseits aber auch immer wieder so eine gewisse Abwiegelung, dass man schon sicher genug sei hier in der Bundesrepublik und niemand jetzt Panik haben müsste. Und das war natürlich auch das große Argument gegen die Friedensbewegung in den 80er-Jahren, dass die zur Panikmache beitragen würde, indem sie diese vielen Informationen in die Bevölkerung ventilierend.
Greta Civis: Und heute, es gibt nach wie vor Atomwaffen, aber die Gefahr eines Atomkrieges ist, ich glaube, vor zwei Jahren immer mal so ein bisschen erwähnt worden. Und inzwischen, habe ich den Eindruck, wird da wenig drüber geredet. Haben wir uns einfach gewöhnt an Atomangst so in den letzten 50 Jahren? Oder was ist da los?
Claudia Kemper: Ich glaube nicht, dass wir uns an Atomangst gewöhnt haben. Ich befürchte nur, dass sie auf der Prioritätenliste der verschiedenen Ängste ganz weit nach unten gerutscht ist.
Und wenn man jemanden fragen würde, der oder die selbst auch gar nicht so viel Ahnung hat, würde wohl jeder sagen, ja, ganz hochgradig gefährlich, bitte abschaffen, wenn man kann. Und dennoch ist es nicht präsent. Und das liegt auch daran, dass ein Atomschlag nicht mehr prinzipiell zur Militärstrategie gehört. So ungleich die Konflikte gelagert sind und so unberechenbar die Konfliktparteien sind in der Gegenwart, von Russland über Nordkorea, China, USA muss mit erwähnt werden. So klar ist auch dass die jetzt nicht einen Atomkrieg in ihrer Militärstrategie vorgesehen haben
Gleichwohl haben alle Militärstrategie vorgesehen dass auch Atomwaffen in irgendeiner Form eingesetzt werden könnten. Aber nicht als erstes Mittel unbedingt, sondern vielleicht im Falle des Falles. Und längst sind andere Bedrohungsszenarien viel präsenter, wie schon der erwähnte Cyberspace, in dem Krieg geführt wird oder Drohnenangriffe, die sehr viel agiler sind, sehr viel kleinteiliger und gleichzeitig viel zerstörerischer, wie wir in der Ukraine ja sehen. Aber auch bei den vielen Grenzverletzungen, die jetzt in letzter Zeit in Osteuropa verzeichnet worden sind.
Und das ist natürlich etwas sehr viel Unmittelbareres, was in der Öffentlichkeit präsent ist. Das könnte einen auch jederzeit selbst betreffen. Und insofern rücken die Atomwaffen im Bewusstsein natürlich weiter nach hinten.
Greta Civis: Also sowas wie ein Totalausfall der Infrastruktur, Elektrizität, Klärwerke.
Claudia Kemper: Absolut. Das ist auch das, was der Bevölkerungsschutz populärer macht zurzeit. Während des Kalten Krieges hieß der Bevölkerungsschutz, so heißt er heute, der Zivilschutz. Und damals war der Schutz vor einem Atomschlag erste Priorität. Und worum sich der Bevölkerungsschutz heute kümmert und versucht aufzuklären, ist, dass man sich schützen soll davor, dass man vielleicht für eine ganze Weile lang abgeschnitten wird von der Infrastruktur.
Greta Civis: Und würdest du sagen, das wird ähnlich proaktiv betrieben, wie es in den 60ern und 70ern betrieben wurde, diese Aufklärung?
Claudia Kemper: Da gibt es eine interessante Parallele, finde ich, was den Zivilschutz und Bevölkerungsschutz angeht. Denn sowohl damals wie auch heute liegt das Wissen auf dem Tisch und sind sämtliche Akteure in diesem Bereich sehr, sehr aktiv, fordern noch mehr Aufklärung, fordern mehr Geld von der Bundesregierung, um aufklären zu können; fordern sehr viel von der Bevölkerung auch, dass sie Eigeninitiativ wird und sich in sich schützt.
Und gleichzeitig steht sie einer Bevölkerung gegenüber, die so ein bisschen den Eindruck von Überforderung macht. Was soll ich denn noch alles tun? Okay, ich stelle drei große Flaschen Wasser mal in den Keller und ein paar Konservendosen. Aber ansonsten habe ich wirklich noch viel andere Probleme. Also so macht das so ein bisschen den Eindruck, dass das der Stand des Bevölkerungsschutzes ist in der Bundesrepublik, anders als in anderen Ländern, die vielleicht auch sehr viel mehr Erfahrung, Erfahrungswissen haben mit Naturkatastrophen zum Beispiel, wo eben der Selbstschutz eine ganz andere Tradition hat.
Greta Civis: Kannst du das konkretisieren?
Claudia Kemper: Na, die USA sind dafür ein ganz gutes Beispiel, die erstmal sehr viel mehr Fläche haben und dadurch sehr viel mehr darauf angewiesen sind, dass sich Bevölkerung selbst organisiert im Falle einer Überschwemmung, eines Erdbebens, eines Hurricanes und sowas. Und deswegen die Möglichkeit der Selbstversorgung sehr viel stärker verbreitet ist.
Großbritannien ist, glaube ich, auch noch mal so ein Beispiel, wo das sehr viel populärer ist, durchaus auch sich selbst zu schützen. Die Schweiz sind das Land, in dem vorgeschrieben ist, dass alle Neubauten einen Bunker eingebaut haben. Die Schweiz war während des Kalten Krieges ein neutraler Staat und hat in dieser Zeit eine extrem verbreitete Selbstschutzkultur entwickelt. Und sieht das eben vor, dass alle in der Lage sein sollen, sich im Falle des Falles, was auch immer der Fall dann ist, schützen kann.
Greta Civis: Das heißt, also die durchschnittliche US-Amerikanerin, die durchschnittliche Schweizerin, Länderin hat so was wie eine innere Checkliste. Wenn das passiert, dann mache ich das.
Claudia Kemper_ Das ist so die Idee, die zumindest in weiten Teilen verbreitet ist. Und das ist, glaube ich, eine Selbstverständlichkeit, die sich in der Bundesrepublik so längst nicht etabliert hat. Aus verschiedenen Gründen, aber es erklärt auf jeden Fall, warum Bevölkerungsschutz nach wie vor selbst in Zeiten, wenn die Wetterphänomene immer krasser werden und auch die Auswirkungen dessen immer krasser werden, noch längst nicht so verbreitet ist, wie es eigentlich angemessen sein sollte.
Greta Civis: Der Kalte Krieg blieb ja kalt, der wurde nie heiß. Das ist eigentlich eine schöne Geschichte, wenn man sich mal so klar macht. Also es hat niemand irgendwie, auch kein verantwortlicher Politiker, waren ja größtenteils Männer, hat in Panik jemals den roten Knopf gedrückt. War das auch ein Erfolg der Friedensbewegung? Und gibt es eine, naja, wir sind jetzt in heißen Kriegen, wie stehen unsere Chancen auf ein glimpfliches Ende, zumindest in unseren Breitengraden?
Claudia Kemper: Der Kalte Krieg ist kein heißer Krieg geworden, das ist in der Tat das gute Ende des Kalten Krieges. Und zu einem Teil auf indirekte Art und Weise hat auch die Friedensbewegung, haben die Friedensbewegung in den verschiedenen Ländern dazu beigetragen. Denn das Bewusstsein über die Gefahren und die Risiken dieser gegenseitigen atomaren Bedrohung ist in dieser Zeit einfach immens gestiegen.
Und Regierungen konnten einfach nicht mehr davon ausgehen, dass es so etwas wie einen atomaren Konsens gibt. Atomarer Konsens meint, dass es eine gewisse Selbstverständlichkeit gibt, dass man eben atomar bewaffnet ist. Und das war Mitte der 80er Jahre schon nicht mehr so durchzuhalten. Und hinzu kam ein ganz gravierendes Ereignis, das war eben 1986, der Super-Gau im Kernkraftwerk von Tschernobyl, wo eben völlig klar war, wenn es denn doch mal zu einem Atomschlag käme und sich Radioaktivität in der Fläche verteilt, was das eben bedeutet konkret für das Leben.
Also das war quasi der Praxisfall, den niemand je haben wollte, auf kleinstem Niveau. Also wir reden dann darüber, dass eben Kinder nicht mehr draußen spielen sollten, man sollte keine Milch mehr trinken, weil es eben diesen Fallout gegeben hat in ganz Europa der Radioaktivität. Aber mit diesem Ereignis war dann endgültig das Thema Atomarer Konsens durch. Und da hat eben die Friedensbewegung und die Umweltbewegung, die Anti-AKW-Bewegung erheblich zu beigetragen.
Aber letztendlich den Kalten Krieg beendet hat natürlich der Zusammenbruch der Sowjetunion, die aus verschiedenen Gründen zusammengebrochen ist. Und sicherlich nicht alleine deswegen, weil die USA, die NATO sie zu Tode gerüstet hat, sondern da kamen ganz viele andere Faktoren hinzu.
Greta Civis: Innere Faktoren auch.
Claudia Kemper: Ganz viele innere Faktoren, klar, auf jeden Fall auch.
Greta Civis: Und wie steht es heute für uns? Haben wir eine Chance darauf, dass wir nicht Teil eines heißen Krieges werden?
Claudia Kemper: Berechtigte Frage. Chancen gibt es immer. Ich kann da jetzt nur als Historikerin beantworten und verweisen auf eben vergangene Konflikte, die immer kurz vorm Kollaps waren und kurz vor der Eskalation und dann aus faszinierenden Gründen teilweise zu einem Ende gekommen sind, aus teilweise auch völlig unvorhersehbar. Und dafür ist der Kalte Krieg wirklich ein Lehrstück. Niemand, niemand hat 1988 und auch noch Anfang der 1989 vorhergesehen, was in dieser rasend kurzen Zeit in der Sowjetunion, in anderen Ostblockstaaten passieren würde und alle waren, glaube ich, auch überfordert mit dieser Situation, als dann der Kalte Krieg auf diese Art und Weise zu Ende ging.
Aber es ist eben ein Lehrstück dafür, dass Konflikte gemanagt werden können einerseits, aber andererseits eben auch ganz viel Unwägbarkeiten mit sich bringen und plötzlich Wendungen annehmen, mit denen man überhaupt nicht rechnet.
Greta Civis:
Dann hoffen wir mal auf das Beste. Liebe Claudia, danke für deine Zeit.
Claudia Kemper Sehr gerne.
Greta Civis: Und wenn ihr jetzt auch denkt, dass es sich lohnt, mehr über den Kalten Krieg und sein Ende in Westfalen und Lippe zu erfahren, dann empfehle ich euch natürlich die Doku Achtung ABC-Alarm. Die ist zum Beispiel auf YouTube leicht findbar im Kanal des LWL-Medienzentrums für Westfalen. Von Claudia Kemper gibt es dazu zum Beispiel den Aufsatz „Bomben vor Ort, globale Kritik und regionaler Protest während des Kalten Krieges“ im Sammelband „Varianten des Wandels“, herausgegeben von Matthias Frese, Thomas Küster und Malte Thiesen am LWL-Institut für Westfälische Regionalgeschichte.
In der nächsten Folge geht's ins Museum. In Westfalen und Lippe gibt es an die 300 Heimatmuseen, Heimatstuben und so weiter. Zu den spannendsten dieser im Allgemeinen ehrenamtlichen Projekte gehört sicherlich das Sackmuseum in Nieheim. Einen Besuch vor Ort habe ich genutzt, um nicht nur mit den Machern über den Sack an und für sich zu sprechen, sondern auch mit Hauke Kutscher vom LWL-Museumsamt über kleine ehrenamtliche oder auch wilde Museen im LWL-Gebiet.
Regionalgeschichte auf die Ohren Untold Stories Westfalens verborgene Geschichten erzählen Dieser Podcast ist eine Koproduktion des LWL Medienzentrums für Westfalen und des LWL Instituts für westfälische Regionalgeschichte Das Projekt wird von der LWL Kulturstiftung im Rahmen des Kulturprogramms zum Jubiläumsjahr 2025, 1250 Jahre Westfalen, gefördert. Schirmherr des Kulturprogramms ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.