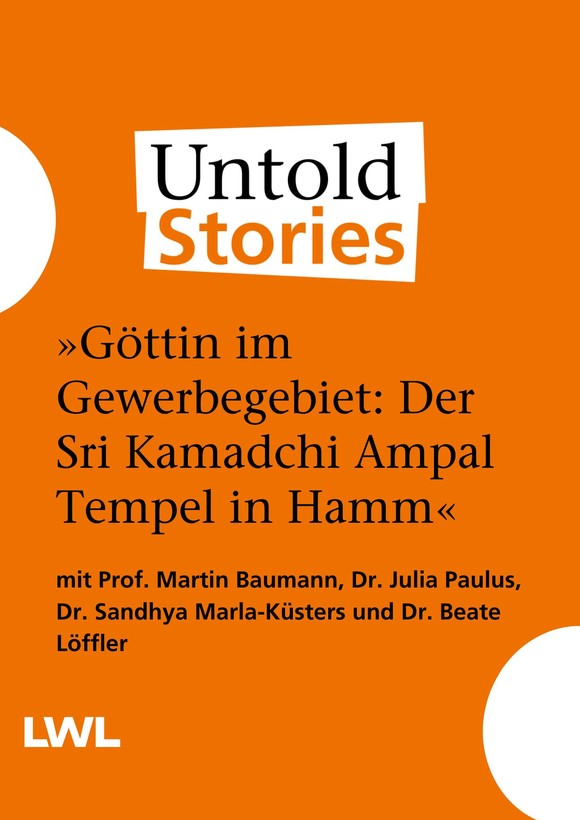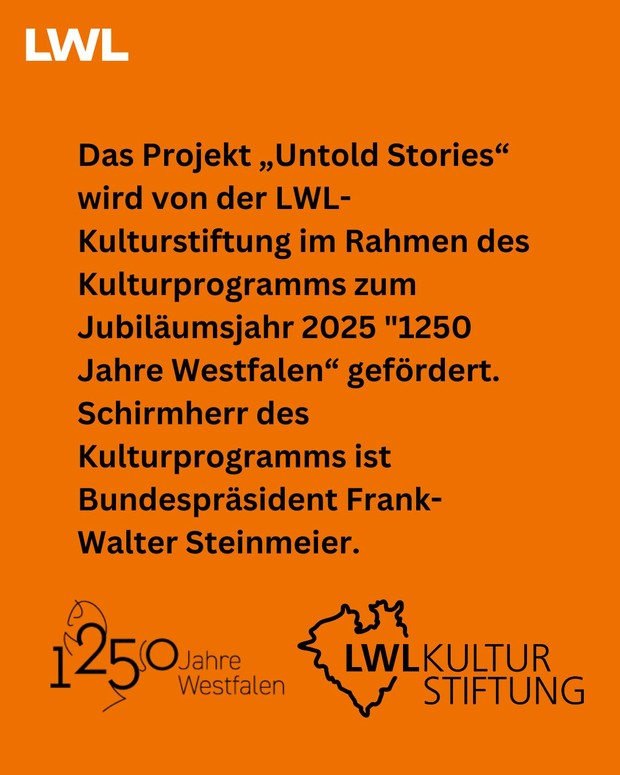Regionalgeschichte auf die Ohren
Greta Civis: Hamm in Westfalen: Dort hektisch von einem Zugteil in den anderen zu rennen, ist wahrscheinlich eine Erfahrung, die die meisten von uns schon einmal gemacht haben. Sonst landet man am Ende noch in Köln statt in Dortmund. 1985 stieg jedoch einer aus statt um. Der hinduistische Priester Siva Sri Arumugam Paskarakurukkal – oder kurz: Priester Paskaran - landete eher zufällig in der Stadt am Rand des Ruhrgebiets. Er blieb und baute einen Tempel. Damit veränderte er die Stadt und ihre Wahrnehmung in Europa: Statt der legendären Zugteilung denken nun zumindest Europäische Hindus bei „Hamm in Westfalen“ nämlich vor allem an den Sri Kamadchi-Tempel in Hamm-Uentrop.
Was diesen Tempel ausmacht und wie es sich überhaupt verhält mit neuen Religionen und religiösen Orten in Westfalen und darüber hinaus, dazu habe ich mit Professor Martin Baumann, Dr. Julia Paulus, Dr. Sandhya Malaküstas und Dr. Beate Löffler gesprochen. Mit Priester Paskaran und anderen aus dem Umfeld der hinduistischen Gemeinde habe ich Hintergrundgespräche führen können -leider hat er nicht die Zeit gefunden, am Podcast teilzunehmen. Allen, die mich bei der Recherche unterstützt haben, danke ich ganz herzlich. Ich bin Greta Civis.
Göttin im Gewerbegebiet. Der Sri Kamaji Ampal Tempel in Hamm.
Kurz vorab. Wer nicht bisher und auch um Folgenden von Hinduismus rede, dann erweckt das vielleicht den Eindruck einer geschlossenen Religion. Doch das ist nicht so. Auf Wikipedia steht beispielsweise:
Der Hinduismus ist mit rund einer Milliarde Anhängern und einem Anteil von etwa 15 % der Weltbevölkerung nach dem Christentum und dem Islam die drittgrößte Religionsgruppe der Erde oder, genauer gesagt, ein vielgestaltiger Religionskomplex. Seinen Ursprung hat er in Indien. Der Begriff „Hinduismus“ umfasst einen Komplex religiöser Traditionen und gesellschaftlicher Phänomene, die teilweise sehr unterschiedliche sozioökonomische, historische und geographische Bedingungen haben.
Dazu später mehr.
2002 wurde der Tempel eingeweiht, das ist nun, 2025, 23 Jahre her. Es lohnt also, einmal zurückzublicken. Was den Tempel so besonders macht, das erscheint einfach – auf den ersten Blick. Der Sri Kamadchi Tempel, also der Tempel der heiligen Dame Kamadchi - eine Inkarnation der Gattin Shivas - ist der größte hinduistische Tempel im südindischen Stil in Europa. Die Ausmaße sind beeindruckend, über 700 qm Grundfläche und bis zu 17 Meter Höhe am Gopuram, also dem Tempelturm mit Portal. Nur in London gibt es noch einen Tempel der größer ist, und der ist nordindischen Stils.
Die Gemeinde umfasst nach eigenen Angaben etwa 6000 Mitglieder. Zum Vergleich. Evangelische Kirchengemeinden haben im Durchschnitt 1400 Mitglieder, katholische noch weniger. Und seit 2017 ist die hinduistische Gemeinde Körperschaft des öffentlichen Rechts. Damit ist sie in NRW nicht nur staatlich anerkannte Religionsgemeinschaft, sondern den christlichen Kirchen rechtlich gleichgestellt, steuerlich, seelsorgerisch und im Hinblick auf eigene Autonomie.
Im Gegenzug muss die Gemeinde nicht nur eine echte, also auch dauerhafte, stabile Religionsgemeinschaft sein, sondern sich auch rechtstreu, also entsprechend deutscher Rechte und Gesetze verhalten, transparent, tolerant und orientiert am Gemeinwohl.
Anders als bei den christlichen Gemeinden kommen die Mitglieder des Srikamaji-Tempels jedoch nicht überwiegend aus der unmittelbaren Nachbarschaft. Das sieht man zum Beispiel zu Zeiten des Tempelfestes auch an den Nummernschildern. Es wird dann international in Hamm-Uentrop. Aus Belgien, Frankreich, den Niederlanden, Dänemark, 10.000 Gäste sind keine Ausnahme beim gut zweiwöchigen Tempelfest. Es ist dann laut und voll und sehr bunt am Tempel. Es gibt scharfes Essen und mehr.
Martin Baumann ist Professor für Religionswissenschaft an der Universität Luzern in der Schweiz. Und er hilft uns, das alles besser einordnen zu können.
Martin Baumann: Es ist wichtig, Hinduismus erstmal als Vielfalt zu denken. Der Begriff selber unterstellt eine Einheitlichkeit, ähnlich wie der Islam oder das Christentum. Auch wenn man hier auf diese Religion schaut, ist eine große Vielfalt vorhanden, gerade wenn wir im islamischen Tradition schauen, wie unterschiedlich diese ausgeprägt sind dann oder in den christlichen Traditionen zwischen orthodoxen Traditionen, katholischen oder protestantischen.
Ähnlich muss man sich das mit dem Hinduismus vorstellen. Der ist gewissermaßen eine Singularisierung oder eine Homogenisierung von einer großen Vielfalt der Religionen Indiens, der hinduistisch geprägten Religionen Indiens. Und diese Vielfalt zeigt sich auch dann in der Diaspora, zeigt sich auch außerhalb Indiens, wo eben dann Migranten hingekommen sind, beziehungsweise wo neue hinduistische Religionen und Traditionen und Gurus hingekommen sind nach Amerika oder eben nach Europa und hier eben dann ihre jeweiligen Traditionslinien etabliert haben.
Die hinduistische Gemeinde des Sri Kamachiyampa-Tempels in Hamm-Uentrop ist ja öffentlich-rechtlich anerkannt. Und eine Voraussetzung für diese öffentlich-rechtliche Anerkennung ist eben, dass sie auch mit den anderen Traditionen zusammenarbeitet bzw. diese vertritt. Im Tempel selber haben wir eine Vielfalt unterschiedlicher hinduistischer Traditionen, sowohl von Shakti, das ist die Göttin-Tradition, als auch der Shiva das ist der große asketische Gott oder der Vishnu das ist hier etwa der Krishnagottheiten, die hier verehrt werden.
Insofern die verschiedenen hinduistischen Traditionen sozusagen Mainline sind in diesem Tempel vorhanden, plus teilweise auch, was dann an Guru-Kulten, an Guru-Traditionen dann ist, wie etwa die Hare Krishna-Bewegung dann. Aber eben diese Gemeinschaft ist hauptsächlich geprägt durch shivaistische Ausrichtung, also der Gott Shiva und seine Söhne stehen im Zentrum und eben die Shakti-Tradition, die große Göttin.
Der großen Göttin ist dieser Tempel gewidmet dann, Shri Kamachi Ampal, eine südindische Göttin. Dann damit ist sehr deutlich auch dieser Shakti-Kult, also Shakti ist die Kraft, die weibliche Energie, dann ist hier dann sehr präsent und sehr dominant dann auch. Und von dieser ist der Hauptpriester Sri Bhaskaran dann eben auch ein großer Verehrer.
Typisch für die Diaspora ist, dass hier eine Vielfalt von Strömungen an einem Platz praktiziert wird. Das hat teilweise auch mit den Engpässen der Diaspora zu tun. Also fern des einzigen Heimatlandes hier ein neues kultisches Zentrum aufzubauen in der Ritualen durchgeführt werden. Hier werden eben auch Götter verehrt in einem Tempel, die man so in Indien kaum antreffen würde. Das hat den Vorteil, dass eben Gläubige aus der Vishnu-Tradition eben auch hinkommen können, als auch eben aus der Shiva-Tradition, als der Shakti-Tradition.
Diese Offenheit ist insofern gegeben, dass eben auch viele Gläubige sagen, ich verehre diese, habe eine bestimmte Gottheit, eine bestimmte Göttin als meine Zentralgöttin, aber ich verehre auch weitere Götter oder Göttinnen dann, weil sie für bestimmte Dinge zuständig sind. Also wenn eine Familie beispielsweise über eine Zeit kinderlos ist, pilgert man zu großen Götter, den Durga hin, weil diese eben dann auch hilft, hier Kinder zu bekommen. Man kann aber auch zu anderen Göttern für andere Problemlage, andere Herausforderungen pilgern.
Insofern ist es ein Nebeneinander dann, in der eben die verschiedenen Götter und verschiedenen Rituale und Frömmigkeitsformen akzeptiert werden und nicht ausschließend sind. Das heißt nicht ausschließend wie im Christentum, wenn jemand Protestant ist, schließt es aus, dass dieser auch Gläubige in der katholischen Tradition ist. Das wäre es nicht hier. Wenn jemand sozusagen die große Göttin Sri Kamachi Ampal als ihre Hauptgottin hat, schließt es nicht aus, jetzt auch meinetwegen den großen Gott Shiva oder den großen Gott Vishnu zu verehren. Diese Exklusivität ist hier in der Hindu-Tradition in vielen Bereichen nicht gegeben und in der Diaspora ohnehin ein bisschen durchlässiger dann.
Greta Civis: Es scheint also, dass eine gewisse Flexibilität in religiösen Dingen in der Diaspora befördert wird. Annette Wilke, ehemals Professorin für Religionswissenschaften an der Uni Münster, schrieb von „Traditionsverdichtung“ und weiter, „Hamm ist eine Bühne oder ein Raum der Mediation für eine weit größere Hindu-Kommunität als nur die Kamadchi-Verehrer“.
Und nicht nur für Hindus ist der Hammertempel ein Ort für Erfahrungen. Dr. Sandhya Mala-Küsters ist Trainerin für Diversity-Kompetenz und kulturelle Vielfalt:
Dr. Sandhya Mala-Küsters: Es ist ja so, dass ein heiliger Ort in eine nicht-hinduistische Umwelt integriert wurde sozusagen, dort hineingepflanzt wurde. Und das geht natürlich einher mit Prozessen der Auseinandersetzung. Also das wird natürlich in Gang gesetzt. Und ich habe zum Beispiel schon viele Fortbildungen gegeben für Lehrer:innen, für Schulklassen, wo wir über das Thema Hinduismus gesprochen haben, meistens im Rahmen des Religionsunterrichts. Und dann fährt man dahin und macht dann mal eine Exkursion. Und das ist natürlich was Tolles, dass es so eine Möglichkeit gibt. Da sind wir immer auf ganz, ganz offene Arme gestoßen.
Die jungen Leute lernen natürlich anders, als wenn sie aus einem Textbuch sowas lernen. Und weil das auch was ganz Besonderes ist, wie man so als Gast behandelt wird in so einem Tempel. Das ist schon alleine eine ganz wertvolle Erfahrung. Und dann, wenn man sich so umschaut und Menschen, die weiß sind, sich plötzlich in der Minderheit fühlen. Also sie sind umgeben von Menschen, die eine andere Hautfarbe haben, fremdländische Gerüche, laute Musik, alles ist anders. Dann fördert es natürlich auch das Empathievermögen und damit auch eine interkulturelle Kompetenz.
Also sich einmal in dieser Minderheitenrolle zu fühlen, vielleicht sogar auch ein bisschen Stress zu empfinden. Ich nehme das ganz bewusst auch nicht in den Fortbildungen, weil ich denke, das ist total wichtig, mal selber zu fühlen, wie es sich, also wie das eben ist, wenn man auch gerade gar nicht weiß, was ist jetzt der nächste Schritt hier rituell. Da gibt es Menschen, die dann sehr, sehr nervös werden. Und da mal so nachzuspüren, das ist halt einfach ganz, ganz toll, was so ein Tempel und auch so ein Besuch dann an Erfahrungen mit sich bringen können.
Greta Civis: Hamm ist also ein Zentrum hinduistischer Praxis in Europa. Doch wie kam das eigentlich? Dabei geht es einerseits um Weltgeschichte, andererseits um die beharrliche Arbeit eines einzelnen Mannes und um Zufälle; oder, je nach Perspektive, um Vorsehung. Der Priester Sri Paskaran stammt wie die Mehrheit der Gemeindemitglieder aus Sri Lanka. Von dort flohen ab 1983 viele vor dem Bürgerkrieg, insbesondere in den 1990er Jahren. Zu dieser Zeit gab es wenige Hindus in Deutschland und keine nennenswerte Organisation.
Bereits 1985 war Priester Paskaran in Deutschland im Zug unterwegs. Hinduistische Logistik gab es damals in der Bundesrepublik so gut wie gar nicht und der Priester muss Speisevorschriften einhalten. Essen kann dann auf einer längeren Fahrt schwierig werden. In Hamm wurde er von anderen Exil-Tamilen zum Essen eingeladen. Er stieg aus und blieb.
Die hinduistische Gemeinde ist eine junge Religionsgemeinschaft in Westfalen. Wie ordnet sich diese in die Geschichte der Migration nach Westfalen ein? Wie steht es überhaupt um Migration und Religion in Westfalen? Dazu Dr. Julia Paulus, wissenschaftliche Referentin am LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte.
Julia Paulus: Also sieht man von der langen, über tausendjährigen Migrationsgeschichte der jüdischen Diaspora ab, dann haben wir in Westfalen eine relativ lange Migrationsgeschichte seit der Franz Revolution mindestens. Da gab es die Katholiken,Katholikinnen die nach der Franz Revolution die Kaisertreuen hier nach Westfalen, unter anderem auch nach Westfalen kamen. Es gab natürlich die sogenannten Ruhrpolen. Das waren diejenigen, die im Ruhrgebiet als Arbeitsmigranten im 19. Jahrhundert im Bergbau gearbeitet haben. Beide Gruppen waren übrigens katholisch. Das ist ganz wichtig an dieser Stelle. Genauso wie die ersten sogenannten Gastarbeiter:innen, die ab den 50er Jahren auch nach Westfalen kamen und zunächst aus Italien und Portugal.
Und das waren, und das ist auch wieder wichtig, es waren auch zuerst Katholik:innen gewesen, die, und das ist eben interessant, hier in Westfalen auf ein Feld stießen, wo sehr viele katholische Wohlfahrtsvereine waren, die sich ihre annahmen. Das war ein wenig anders dann bei den griechisch-orthodoxen, also die hierher kamen und die Religion hatten griechisch-orthodox. Die hatten kein unmittelbares Gegenüber und da haben sich dann die protestantischen Wohlfahrtsverbände dieser Gruppe angenommen.
Wer große Probleme hatten, das waren die türkischen Gastarbeiter:innen. Als Muslime, Muslima hatten sie kein unmittelbares Gegenüber. Weder die katholischen noch die evangelischen Wohlfahrtsverbände haben sich ihrer angenommen, unmittelbar zumindest nicht; sodass sich private Initiativen dann um sie bemühten und versuchten dann sozusagen auch Unterstützung zu leisten. Das Problem bei diesen Gruppen war, wo bekommen wir eine Unterkunft für die Ausübung sozusagen auch unserer religiösen Riten. Das war bei den Katholiken, bei den Protestantinnen eben wie gesagt nicht ganz so schwierig. Und so wurden dann Muslimer und Muslima verwiesen auf private Unterkünfte oder sie mieteten sich einen Lagerraum an, um mit mehreren sozusagen zusammen ihre Riten feiern zu können.
Greta Civis: Soweit ähnelt die Situation der hinduistischen Gemeinde der vieler neuer religiöser Gruppen. Es fehlt am Platz. Ein erster Tempel eröffnete 1989 in einem Wohnbezirk in Hamm. Die Gemeinde wuchs und auch ihre Bedarfe. Parkplätze wurden ein Konfliktfeld, so erzählten es mir Priester Paskaran und sein Sohn. Und seien wir ehrlich, so ein Tempelfest in der Nachbarschaft, das merkt man schon.
In beiderseitigem Einverständnis mit der Stadt wurde ein Bauplatz im Industriegebiet in Hamm-Uentrop gefunden. Und tatsächlich, 17 Jahre später, 2002, wurde der größte Tempel südindischen Stils in Europa eröffnet. Komplett finanziert durch Spenden mit zehntausenden Gästen und erheblicher medialer Aufmerksamkeit. Das neue Gelände bot der Gemeinde einiges, was sie brauchen konnte. Neben reichlich Platz zum Parken und für neue Projekte gab es Zugang zu Wasser.
Fließendes Wasser ist wichtig für hinduistische Riten. Und so ersetzte der Datteln-Hamm-Kanal einige Jahre den Ganges. Vor kurzem wurde ein eigener Teich mit Wasserfall angelegt, so dass der Wasserzugang auf eigenem Gelände und ohne behördliche Genehmigung erfolgen kann. Diese war nämlich bei der Wasserstraße oder Wasserautobahn, die der Datteln-Hamm-Kanal ist, immer nötig gewesen.
Und auch insgesamt wächst das Projekt Tempel beständig weiter. Es gibt ein Kulturzentrum, Pfauen und das Außengelände wird beständig weiter bespielt. Manches klappt, manches nicht. Die Gemeinde entwickelt sich.
Der Sri Kamaji-Tempel ist mit seiner Geschichte besonders, dennoch. In Westfalen, in der Bundesrepublik, gibt es immer wieder religiöse Gebäude, die in die Randbezirke in Gewerbegebiete abwandern. Ein Sakralbau im Gewerbegebiet. Das erscheint irgendwie kontraintuitiv. Beate Löffler von der Ruhr-Uni Bochum arbeitet unter anderem zu „Sakraltopografie“ in urbanen Räumen. Mit ihr habe ich mich zu diesem Thema unterhalten.
Beate Löffler: Wenn wir jetzt mal schauen auf die neu angekommenen Religionen. Also Sie haben ja auch untersucht, wo die sind, die Religionen. Und Sie haben immer wieder den Bezug zu Roland Barthes mit den Funktionen des Urbanen, wo eben auch die religiösen Bauten zum urbanen Raum gehören. Und dann sehen wir aber, dass sich sowohl neue Moscheen als auch eben Bauten wie der Sri Kamadchi-Tempel in Hamm dann ins Industriegebiet verlagern.
Greta Civis: Ist das ein Ausdruck von einem Empfinden, dass Religion Privatsache ist? Das konzentrieren Sie ja auch. Ist das ein Resultat davon, dass in den Städten kein Platz ist? Ist das ein Ausdruck von Marginalisierung von nicht-christlichen Religionen? Was ist das?
Beate Löffler: Ich glaube, es ist eine Mischung aus allen und es ist, also dass kein Platz ist ganz wichtig, aber es ist auch eine Frage, ob man sich den Platz kaufen kann, wenn er denn zur Verfügung steht. Und also die Rolle des Immobilienmarktes auf die Entwicklung der religiösen Gemeinschaften, auf ihre Spielräume im Stadtraum ist meines Erachtens noch ein bisschen unterbelichtet. Das mit der Marginalisierung sehe ich nicht ganz so pessimistisch. Ich sehe das Bauen von eigenen für Gemeinden, die man im weitesten Sinne mit einem Zuwanderungshintergrund beschreiben könnte, durchaus als einen Schritt zur Sichtbarkeit, zur Beheimatung, zum Zeigen einer Präsenz vor Ort.
Und das ist eine Verstetigung von Gemeinden, die oft, wie wir das in unseren Erhebungen gesehen haben, oft Jahrzehnte hinweg von einem Interim zum anderen wandern und dann irgendwann den Punkt erreichen wo sie stabil genug sind als Gemeinschaft stabil genug sind in ihrer soziokulturellen Position in Deutschland, dass sie auch in der Lage sind mit den kommunalen Behörden zu kooperieren, was nötig ist, um einen Bauantrag durchzubekommen zum Beispiel. Und das wirtschaftliche Vermögen entwickeln, sich ein Grundstück zu kaufen oder zu pachten und den Bauprozess zu finanzieren. Und insofern sehe ich alle Neubauten, auch größer angelegte Umnutzung, tatsächlich als ein Ergebnis einer Beheimatung und auch ein gesellschaftliches Sichtbarwerden.
Und für uns als Gesamtgesellschaft sehe ich das als Zwischenstadium in der Entwicklung der Gemeinden, in der weiteren Beheimatung von religiöser Vielfalt und als einen guten Aufhänger und darüber zu verständigen, was wir mit Stadtreligionsfreiheit und Teilhabe eigentlich meinen. Wie viel Spielraum wollen wir einräumen oder auch nicht? Wie viel Spielraum oder welche Position hat das Christentum oder hat Religion an sich für uns? Und die Auseinandersetzung mit den Neubauten der hinzugekommenen religiösen Minderheiten ist die Plattform, wo wir das aushandeln können und wo wir wahrscheinlich auch müssen.
In der europäischen Tradition, wie wir Gottesdienstraum in der Stadt verankern, sind Gottesdiensträume Zentren sozialen Lebens, die eingebunden sind in die normalen Tagesabläufe. Man kann vor der Arbeit zum Gottesdienst gehen, man kann nach der Arbeit zum Gottesdienst gehen, man trifft sich in der Nachbarschaft, das überlagert sich. Das ist etwas, was für Pendlergemeinden ohnehin wegfällt. Aber um Gottesdiensträume bildet sich eine Art soziale Infrastruktur. Und das sehen wir sehr oft mit Pfarrhaus, Kindergarten, Gottesdienstraum, vielleicht noch Gemeindehaus, wo ja nicht nur die kircheninternen Funktionen gebündelt sind, sondern eben auch Nachbarschaftstätigkeiten zusammenkommen. Und das ist im Gewerbegebiet praktisch nicht möglich.
Für das soziale Funktionieren von Stadt halte ich das für eine schlechte Idee. Aber es ist vermöglich im Kostenrahmen dessen, was die Gemeinden machen können. Das Einzige, was zu haben ist, es sei denn, die Städte unterstützen und sagen, wir haben ein kommunales Grundstück in einer innerstädtischen Lage oder zumindest zwischen zwei Wohngebieten. Wir machen euch ein Angebot.
Greta Civis: Und mittlerweile ist der Tempel auch eine der Attraktionen der Stadt oder, wenn man beim Reiseforum TripAdvisor nachschaut, die Top-Attraktion. Und das, obwohl der Tempel abseits im Industriegebiet liegt, rund 20 Autominuten entfernt vom Stadtzentrum und dem Bahnhof. Natürlich wirbt auch die Stadt Hamm mit dem Tempel auf ihrer Webseite.
Seit 2002 nimmt der hinduistische Priester am interreligiösen Friedensgebiet der Stadt teil. Kürzlich wurde ein hinduistischer Teil auf dem kommunalen Friedhof geschaffen. Die Gemeinde gehört zur Stadt. Bleibt noch die Frage, wie geht es weiter? Was nehmen wir mit? Dazu noch einmal Beate Löffler.
Beate Löffler: Ich denke, wir haben uns damit eingerichtet, dass die Vielfalt der Religionen da ist. Wir haben uns eingerichtet, dass diese Religionen ihren Platz finden in unserem städtischen Bestand, in unseren Nachbarschaften. Und ich vermute, dass der nächste Schritt ist, dass wir uns darüber klar werden wollen, wie viel Sichtbarkeit wir der Religionsfreiheit zubilligen. Das ist das eine, Religionsfreiheit im Privaten zuzulassen und das ist was anderes, Religionsfreiheit, das Ausüben von Religion im geteilten städtischen Raum zuzulassen. Und das ist etwas, von dem ich völlig selbstverständlich annehme, dass das etwas ist, das Gesellschaft aushandeln muss und dass das nicht über Nacht passiert und dass man damit gegebenenfalls fremdelt oder sich überlegt, was für Konsequenzen hat das für mich in meiner Nachbarschaft. Das finde ich völlig selbstverständlich.
Ich denke nur, dass es wahrscheinlich dran ist, sich darüber zu einigen mit den Stimmen Sowohl der Alteingesessenen als auch jener, die neu hinzugekommen sind oder sichtbar werden oder den Weg noch suchen.
Greta Civis: Und ein Schlusswort von Julia Paulus.
Julia Paulus: Ich finde es immer schön, sich dieser Perspektive anzunehmen, um wegzukommen von Klischees, die da heißen, wir haben sozusagen so eine homogene Heimat, die nach ganz bestimmten Regeln und Vorstellungen verläuft. Und der Westfale, die Westfälin ist so oder so. Sondern wenn man den Blick darauf hält, woher die Menschen kommen, was sie auszeichnet, was sie verbindet, was sie vielleicht auch trennt, stellt man fest, dass wir total unterschiedlich sind, dass wir unglaublich divers sind. Und umgekehrt betrachtet, dass gerade diese Diversität, diese unterschiedlichen Herkünfte, diese unterschiedlichen sozialen Zusammenhänge uns erst ausmachen. Als Westfälin in Westfalen.
Vielen Dank noch einmal allen, die mit mir im Vorfeld geredet haben. Ausdrücklich auch noch einmal danke denen, die nicht zu hören waren.
Und wenn ihr jetzt auch mehr wissen wollt über den Hindu-Tempel, über Wandel in der Sakraltopografie oder über das Ankommen in der Bundesrepublik, wir verlinken Quellen zum Weiterlesen in der Folgenbeschreibung bzw. auf der Folgenseite.
Nicht erwähnt haben wir den Film Wiedergeboren in Westfalen von Melanie Liebheit.
Ein anderes zurzeit laufendes Filmprojekt porträtiert Priester Paskaran.
Regionalgeschichte auf die Ohren. Untold Stories. Westfalens verborgene Geschichten erzählen.
Dieser Podcast ist eine Koproduktion des LWL- Medienzentrums für Westfalen und des LWL-Instituts für westfälische Regionalgeschichte. Das Projekt wird von der LWL Kulturstiftung im Rahmen des Kulturprogramms zum Jubiläumsjahr 2025, 1250 Jahre Westfalen, gefördert. Schirmherr des Kulturprogramms ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.