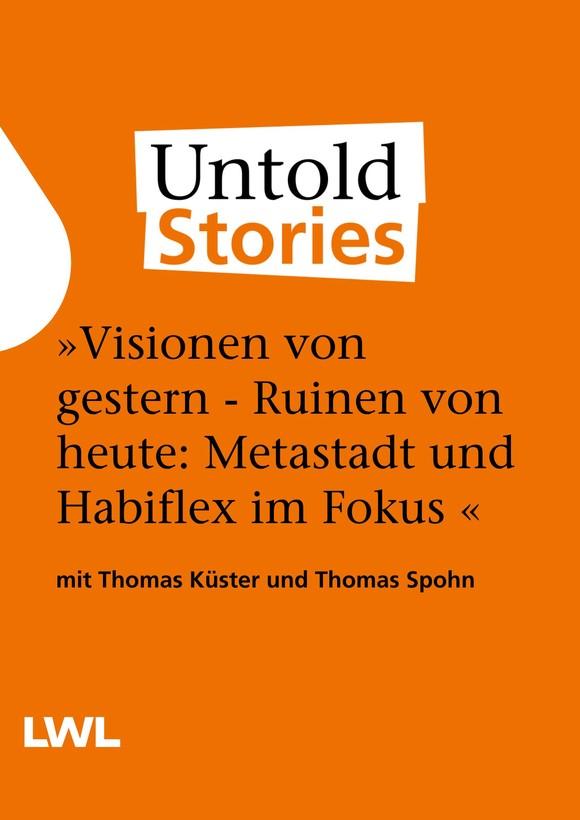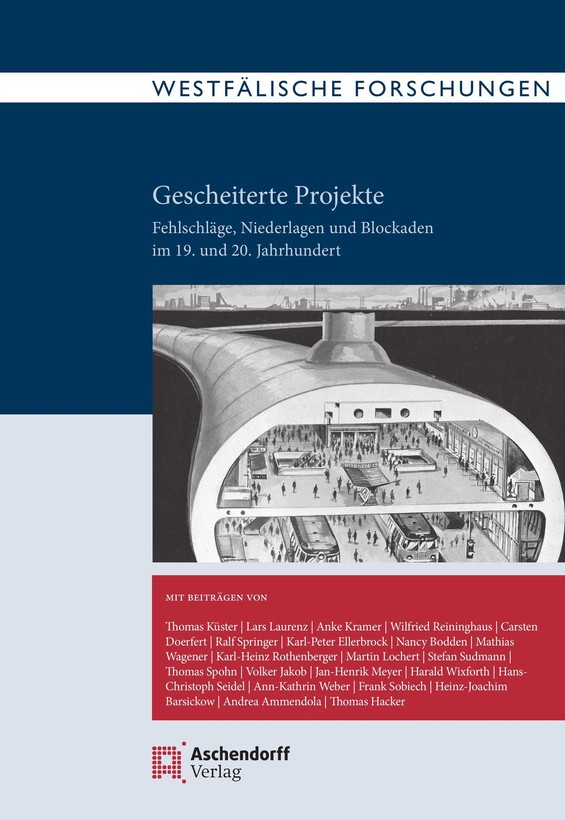Regionalgeschichte auf die Ohren
„Satz mit X, war wohl nichts“ oder „Hinfallen. Ausstehen. Krönchen richte. Weitergehen.“ Jede und jeder kennt Postkarten, Kaffeetassen oder Hemden mit mehr oder weniger humorvollen Sätzen zu einer grundsätzlichen menschlichen Erfahrung, dem Scheitern. Mein persönliches Lieblingszitat stammt wohl von der österreichischen Schauspielerin Sophie Reuss und lautet „Scheitern ist eine anstrengende Tätigkeit“.
Warum Scheitern nicht nur anstrengend ist, sondern auch ein lohnendes Forschungsfeld der Regionalgeschichte sein kann , was das Scheitern beispielsweise vom Niedergang unterscheidet und wie bei Dorsten einmal eine ganze Stadt gescheitert ist, das darf ich heute besprechen mit
Thomas Küster: Thomas Küster
Greta Civis: und
Thomas Spohn: Thomas Spohn.
Greta Civis: Und ich bin Greta Civis.
Visionen von gestern, Ruinen von heute. Metastadt und Habiflex im Fokus.
Herr Küster, Ende letzten Jahres erschien Wand 74 der westfälischen Forschung mit dem Titel Gescheiterte Projekte, Fehlschläge, Niederlagen und Blockaden im 19. und 20. Jahrhundert. Gab es einen Anlass, das Thema aufzugreifen?
Thomas Küster: Nein, einen unmittelbaren Anlass gab es nicht. Allerdings ist Scheitern ein Thema, was mich immer auch schon interessiert hat, weil es so ambivalente Aspekte hat. Scheitern ist im Grunde in Dauerthema auch in der Geschichte. Allerdings mit Konjukturen und auch ruhigeren Phasen wo es kaum thematisiert wird. Man hat schon viel geschrieben und erzählt Römischen Republik oder über das Scheitern der Weimarer Republik, der russischen Demokratien usw. Aber es gab immer auch Phasen, wo man sich gar nicht groß ums Scheitern gekümmert hat, weil Erfolgsgeschichten im Vordergrund standen. Und die Geschichtswissenschaft ist meistens doch etwas mehr auf diese Erfolgsgeschichten ausgerichtet gewesen.
Das hat sich aber in den letzten Jahrzehnten etwas geändert. Es gab ja eine Phase, da war man sehr stark eher an ökonomischen und sozialen Veränderungen interessiert und hat die so als Ursachen benannt für geschichtliche Prozesse. Das ist dann aber abgelöst worden von einer Tendenz, mehr kulturelle und diskursive Fragen zu behandeln und zu schauen, ob da nicht auch Ursachen liegen, mit denen man bestimmte Phänomene erklären kann. Stichwort Kulturgeschichte, die die frühere Sozialgeschichte etwas abgelöst hat.
Und in diesem Kontext ist eben auch das Scheitern wieder interessant geworden, weil Scheitern immer auch eine Verhandlungssache ist. Also das kann man ganz unterschiedlich betrachten. Im Grunde sind Erfolg und Scheitern zwei Seiten einer Medaille. Und so ist es wieder etwas populärer geworden, zuletzt auch durch einen Historikertag, der war im Jahr 2014, der war überschrieben mit dem Thema Gewinner und Verlierer. Und da haben wir uns jetzt sozusagen drangehängt, weil wir immer auch schauen, dass wir allgemeine Tendenzen in die Regionalgeschichte am Beispiel Westfalens natürlich hereinholen.
Greta Civis: Entomologisch scheitern ja wohl tatsächlich das Zerschellen des Schiffsrumpfs zu Holzscheiten.
Thomas Küster: So wird das erklärt. Also natürlich, die Sprachkundler versuchen immer Etymologien zu erstellen und herauszufinden, wo ein Begriff herkommt. Und in der Tat, das wird bezogen auf die Holzscheite, aus denen früher der Schiffsrumpf gebaut war. Und wenn der zerschellt, dann sprach man von Scheitern. Das ist auch deshalb ein ganz treffendes Bild, weil es aussagt, dass man natürlich einerseits Naturkräften ausgesetzt sein kann, die man gar nicht beeinflussen kann. Aber es steckt im Zerschellen eines Schiffs ja immer auch ein Navigationsfehler, für den man selbstverantwortlich sein kann unter Umständen. Also daran sieht man wieder, wie ambivalent das Thema Scheitern im Grunde doch ist.
Greta Civis: Ich weiß nicht, ob man es hört, wir haben diese Baustelle vor dem Haus. Wenn jetzt daran unsere Aufnahme tatsächlich in der Art scheitert, dass wir sie wiederholen müssen, welche Art des Scheiterns wäre das dann?
Thomas Küster: Das wäre ein sehr spezielles, auf besondere Umstände zurückzuführendes Scheitern. Es gibt aber, das hat unser Band, die vielen Beiträge, die wir da gesammelt haben, hat das gezeigt, weil wir viele Beispiele dann miteinander vergleichen konnten. Es gibt immer auch große Gemeinsamkeiten beim Scheitern, wenn man verschiedene Fälle durchbuchstabiert.
Also oft sind die Prognosen einfach zu waghalsig gewesen, oft hat es einfach zu lange gedauert, sodass sich die Umstände um dieses Projekt herum total verändert haben und das Projekt eben nicht mehr funktioniert hat. Oder es haben sich zu viele Leute daran beteiligt. Dann ist es schwierig, sich abzustimmen und klare Entscheidungen zu treffen. Oder die Kommunikation nach außen hin hat nicht gestimmt. Das ist oft der Fall gewesen, wenn ein größeres Projekt auf Widerstand in der Bevölkerung gestoßen ist. Und das alles, was wir ausgewählt haben für unseren Band, waren natürlich Projekte, also Vorhaben, die mit einem konkreten Ziel verbunden waren und die also auch eine gewisse zeitliche Begrenzung an sich haben sollten.
Das sind Projekte und davon zu unterscheiden, Sie haben das ja schon angesprochen in der Einleitung, sind natürlich so Dinge, wo es einen allmählichen Niedergang gibt. Ja, man spricht auch vom Niedergang der Textilindustrie oder des Bergbaus. Das sind keine Vorgänge des Scheiterns nach unserer Auslegung, sondern da stecken die tieferen Ursachen hinter. Das sind also Vorgänge, die man als Strukturwandel bezeichnen könnte, die auch nicht so ohne weiteres von einzelnen Leuten zu beeinflussen sind. Und da bedarf es einer hohen Anpassungsfähigkeit, um damit fertig zu werden. Und endgültig sind die in der Regel auch nicht.
Greta Civis: Der Band vereint ja ganz verschiedene Themen. Es geht zum Beispiel um die Revolution von 48, 49. Es geht um eine vergessene Hochschule, um die Nahrungsmittelproduktion. Es geht um einen Imagefilm für die Stadt Kastrop-Rauxel, die Geschichte der Falken, Olympia im Ruhrgebiet und sehr, sehr viele Bauprojekte, ganz unterschiedliche. Gibt es etwas, wonach die ausgewählt wurden? Sie hatten schon gesagt, die Projekthaftigkeit, also ein Anfang, ein Ende und ein Ziel.
Thomas Küster: Es sollte natürlich zum einen der Projektcharakter gewährleistet sein und zum anderen sollte es immer einen regionalen Bezug möglichst zu Westfalen haben. Das haben wir irgendwie dann auch hinbekommen. Man sichtet halt, was es für Fälle gibt, wo Dinge nicht funktioniert haben oder blockiert worden sind. Und wichtig war eben, dass man die regionale Ebene da immer wieder erkennt. Denn in der Region passiert sehr viel an Scheitern. Das hängt damit zusammen, dass viele auch größere Projekte oft oben auf einer nationalen oder Bundesebene ausgedacht werden und dann aber auf einer regionalen oder kommunalen Ebene umgesetzt werden müssen. Und so passiert eben bei Bezirksregierung, bei Verbänden, auch bei kommunalen Verbänden relativ viel an Projektarbeit. Und es gehört immer zu jedem Projekt dazu, dass das Ergebnis offen ist und eben auch schief gehen kann. Darum war es nicht sehr schwierig, eine ausreichende Zahl an Beispielen zusammenzubekommen für den Band.
Greta Civis: Also Scheitern als wertvolle Perspektive für die Regionalgeschichte und die Region als wertvolle Betrachtungsgröße für Scheiternsgeschichte.
Thomas Küster: Ja, so sehen wir das. Und wie gesagt, es erklärt eben auch viel über Bewertungen, die wir vornehmen. Wir erleben das ja tagtäglich, wie unterschiedlich Bewertungen und Wahrnehmungen ausfallen können. Und so ist es auch mit Projekten, die gescheitert sind.
Es kommt immer wieder vor, dass ein Projekt, das scheinbar erfolgreich war und von den Initiatoren als erfolgreich gesehen wird, von anderen als gescheitert betrachtet wird. Also nehmen Sie ein Bauprojekt, ein Flughafenprojekt oder sowas. Die Initiatoren werden das dann sozusagen als Erfolg werten, wenn der Ausbau gelungen ist. Und die Gegner, die gibt es ja dann auch immer, die werden das als Scheitern betrachten. Oder eben umgekehrt, wenn der Ausbau ins Stocken gerät oder nicht zustande kommt und sozusagen abgeblasen wird, dann haben die Gegner Erfolg gehabt und die Befürworter sind gescheitert. Das sind immer diese beiden Seiten einer Medaille.
Ja, dann gehen wir ins konkrete Beispiel. Schauen wir nach Wulfen. Zunächst, wenn wir auf die Bauprojekte schauen. Da sind ja einige, die nicht verwirklicht wurden, andere, die wieder abgerissen werden mussten und manche, die bis heute diskutiert werden oder unbeliebt sind, weil ganz viele die Gegner haben und zwar nicht zu wenige. Herr Spohn, Sie haben geschrieben über die neue Stadt Wulfen und die Wohnkomplexe Metastadt und Habiflex. Dort gab es ja alle drei Varianten. Die neue Stadt Wulfen wurde nicht verwirklicht, Metastadt wurde wieder abgerissen und Habiflex ist umstritten?
Thomas Spohn: So ist es, aber es ist insgesamt natürlich nicht so einfach wie bei dem scheiternden Schiff. Wenn das auf einen Riff fährt und untergeht, dann ist klar, das ist gescheitert. Das ist ein Projekt und das ging in die Hose. Das ist bei manchen Gebäuden auch so, wenn ich ein Gewölbe bauen will und habe es noch nie vorher probiert, probiere es zum ersten Mal, es stürzt ein, kann man sagen, ja, dieser Bau ist gescheitert. Natürlich lerne ich daraus und wenn ich nicht so wagemutig bin, es trotzdem noch ein zweites Mal zu versuchen, dann geht es natürlich insgesamt nicht weiter mit dem Gewölbebau.
Aber so einfach ist es bei Stadtplanung und bei den Projekten, die es in Wulfen gegeben hat oder noch gibt, nicht gewesen. Das fängt schon damit an, dass die Meinung, ob Wulfen gescheitert ist, durchaus umstritten ist. Das ist eine Wohnstadt am Rande des Ruhrgebiets, die sehr grün ist und die Menschen, die jetzt da wohnen, es sind etwa 10.000, davon 8.000 in dem neuen Teil, Barkenberge, heißt ja eigentlich, die sind da sehr zufrieden mit dem, was sie da erleben.
Es gibt andere Aspekte des Scheiterns. Es gibt andere Aspekte des Scheiterns. Man hat gedacht, der Bergbau wird dort etwa 200.000 Beschäftigte haben in dem Raum Marl-Wulfen. Daraus ist ganz wenig geworden. Über zehn Jahre lang hat der hauptsächlich beteiligte Bergbauunternehmer Hugo Stinnes etwa 900 Leute beschäftigt. Damit ist natürlich mit dieser Stadt auch nicht unbedingt zu erwarten, dass sie dann die geplanten 50.000 Einwohner kriegt. Das heißt, es war eine unrealistische Einschätzung des Bevölkerungszuwachses, der da entsteht.
Greta Civis: Das war in den 60ern, die Planung mit den 50.000?
Thomas Spohn: Die Planung fing 1961 an und man dachte, man braucht eine Stadt nicht allein für Bergwerkleute, sondern braucht eine komplett neue Stadt mit Infrastruktur und einer Diversifizierung auch an Arbeitsplätzen. Man wollte keine Wohnstadt für die südliche gelegenen Großstädte, sondern man wollte ein eigenständiges Gemeinwesen. Das hat nicht funktioniert, einfach weil der Bedarf zum damaligen Zeitpunkt anders sich entwickelt hat, als er optimistisch eingeschätzt wurde.
Greta Civis: Wulfen ist ein Stadtteil von Dorsten heute.
Thomas Spohn: Wulfen war schon immer ein Dorf, was dort in der Gegend lag. Man hat dann bei Wulfen die Sied Wulfen das Projekt Barkenberge, eben die neue Stadt Wulfen, ins Leben gerufen. Und die hat man dann nicht als eigene Stadt, wie ursprünglich geplant, weitergeführt, sondern hat sie eingemeindet. Was schon ein Zeichen dafür ist, dass die Stadtwerdung in Wulfen gescheitert ist. Anders als zum Beispiel nördlich in Westfalen in Esbekamp.
Greta Civis: Und dann war ja diese Stadt auch auf eine bestimmte Art geplant. Es war ja eine Raumstadt geplant, also ein ganz spezifisches Stadtkonzept.
Thomas Spohn: Man wollte nicht so bauen wie in der Neuen Fahr in Bremen oder im Märkischen Viertel in Berlin, sondern man wollte kleinteilige Wohngruppen haben dort. Man hat insgesamt zwölf Siedlungsbereiche mit jeweils etwa 1.000 bis 2.000 Einwohnern geplant und man hat versucht, zum einen sozial zu mischen, sozialen Wohnungsbau zu machen, in verschiedenen Größen in den Einheiten und man hat die damals modernen Vorstellungen versucht umzusetzen, was eine Flexibilität des Wohnens betrifft und was neue Konzepte überhaupt der Stadtarchitektur betrifft. Letzteres nannte sich Metastadt. Ersteres war hauptsächlich das Projekt des Habiflex, der heute noch steht, seit 2008 leer steht und versucht wird, den Erhalt zu sichern, auch mit Mitteln der Denkmalpflege.
Die Metastadt ist nach zehn Jahren 1987 schon wieder abgebrochen worden. Das war damals weltweit diskutiert und die Metastadt in Wulfen war eines der weltweit größten realisierten Projekte für das Konzept: Wir bauen aus einer Stadt, die aus einer Primärstruktur besteht, ein Tragsystem, in das ein Sekundärsystem eingeschoben werden kann, nämlich Raumzellen unterschiedlicher Nutzung.
Greta Civis: Also es ging um flexibles Bauen und es ist auch eine modulare Bauweise, dass eine Reproduzierbarkeit gewährleistet ist.
Thomas Spohn: Eine Ergänzbarkeit in alle Dimensionen.
Und da knüpften sich ganz weitreiche Wünsche und Vorstellung für die Gesellschaft an. Sie hatten zitiert Dörnach, der schrieb, dass sei die einzige Möglichkeit den gesellschaftlichen Starfkrampf zu lösen. Und er schrieb von einer maximalen Verhaltensfreiheit für den Benutzer und Akteur der Stadt. Das entsprechende physische Planungskonzept heißt „maximale dynamische Veränderlichkeit, Wachstumsfähigkeit, Anpassung und Austauschbarkeit“. Und das ist in weiten Teilen, Sie sagen, die Leute sind zufrieden. Dennoch gab es erheblichen Leerstand und das ist nicht so genutzt worden, oder?
Thomas Spohn: Die Leute sind zufrieden mit dem, was jetzt ist. Die Metastadt ist nicht mehr. Trotzdem, die Bewohner der Metastadt selber sollen zufrieden gewesen sein, wenn es nicht so reingerechnet hätte. Dieses Ding hatte Baufehler. Das Konzept ist, ja kann man sagen, Hybris der Architekten und der Stadtplaner. In den 60er Jahren hatten viele Berufsgruppen diese Vorstellung. Also man hat nicht nur eine Mondlandung gehabt, sondern man dachte, der Weltraum ist unser und wir besiedeln den jetzt. Man hat Überschallflugzeuge gebaut, man hat Atomkraftwerke gebaut. Man war euphorisch und auch die Stadtplaner waren euphorisch. Sie dachten, sie können eine neue Form der Stadt bauen, wo man die Funktionen trennt, also wo man eine Stadt baut über der gesamten Infrastruktur, wo man flanieren kann, wo man einkaufen kann und wohnen kann, ohne mit dem, was damals als Moloch bezeichnet wurde, des Verkehrs in Berührung zu kommen. Es war ein super Konzept, alle waren begeistert, auch die Geldgeber waren begeistert, die Politik war begeistert, es war eine wunderschöne Idee.
Es gab Mahner, die ein Scheitern vorhergesehen haben, mit dem auch nicht von Anfang an so klar formulierten Argument, dass eine Struktur, wenn man kilometerweise eine bestehende Region überbauen will, eine Struktur, die neutral ist, sodass alle Nutzungen darin möglich sind, so technisch aufwendig sein muss, um alle diese Nutzungen, die potenziell denkbar sind, zu ermöglichen, zu verwirklichen, dann wird die zu teuer, dann wird die zu anfällig.
Greta Civis: Und das sollte ja vielfach sozialer Wohnungsbau auch sein. Und es sollte ja vielfach sozialer Wohnungsbau auch sein.
Thomas Spohn: Das war die Hoffnung, beziehungsweise war die Behauptung, es könnte gehen. Es ging um Fördermittel und es gab nur Fördermittel für sozialen Wohnungsbau. Da hat man halt gesagt, man probiert es damit. Und es ist auch zum Teil gelungen, weil man auf anderen Kanälen Mittel generieren konnte, die zu einer Finanzierbarkeit geführt haben.
Die Metastadt in Wulfen war als Experiment insofern von vornherein zum Scheitern verurteilt, als sie nicht die Vorteile des Systems ausspielen konnte. Es ist nicht über eine bestehende Stadt mit Eisenbahn, Straßenbahn, eine Struktur gestellt worden, sondern es genauso wie die Nachbarbauung ganz konventionell auf einer grünen Wiese ein solches System entstanden, das zudem noch sehr klein war. Es war ursprünglich von den Planern viel größer dimensioniert, so dass es sich getragen hätte finanziell, wurde dann aber abgespeckt im Laufe der Planungszeit. Und dann blieb ein Torso übrig, der von vornherein gar nicht so nötig gewesen wäre in seiner Megastruktur zur Realisierung dessen, was dann tatsächlich passierte. Ein paar Wohnungen, Kindergarten und einen Supermarkt. Das hätte man auch baulich anders und weniger aufwendig lösen können.
Greta Civis: Reden wir noch mal kurz über die Sachen, die die Leute so begeistert haben. Es waren ja wirklich ein paar schöne Ideen. Ich stelle mir auch einfach vor, das war attraktiv damals, dieses neue Wohnen, sehr sauber, denke ich. So ein Sauberkeitsversprechen. Dann dieses Versprechen von Flexibilität, dass alles umgenutzt werden kann, dass man auch ständig umstellen kann, was aber vielfach dann von den Bewohnern gar nicht so genutzt wurde. Und einen ganz charmanten Aspekt, den man auch immer wieder liest, ist der Gelsenkirchener Balkon. Ich dachte zuerst, ich hätte mich verlesen. Ich dachte, es ging um den Gelsenkirchener Barock, aber das ist was anderes. Der Gelsenkirchener Balkon, wenn ich das richtig verstanden habe, sind das quasi zwei Fenster über Eck, die sich nach außen und nach innen klappen lassen. Je nachdem hat man dann einen Wintergarten oder eben einen Balkon über einer Ecke. Das System hat aber auch nicht so richtig funktioniert, oder?
Thomas Spohn: Technisch schon. Die Idee ist ja ganz faszinierend, dass man nicht eine Wohnung bezieht und man kann an der nur das Sofa dahin stellen oder dorthin stellen, sondern man kann sie auch verändern, entsprechend den Bedürfnissen zum Beispiel einer wachsenden und dann später wieder schrumpfenden Familie, dass man die Zahl der Räume vermehren kann, dabei die Räume natürlich verkleinert, aber so anpassen kann, wie man sie gerade möchte und dabei auch den Balkon einbeziehen kann, wenn man keinen Balkon will, dass man einen zusätzlichen Wohnraum hat. Technisch ist das alles möglich, war und ist im Habiflex alles vorgesehen, aber tatsächlich von den Bewohnern nur theoretisch begrüßt worden.
Praktisch hat es Umsetzungen von Wänden weder im Habiflex noch in den wenigen vergleichbaren Bauten, die es auch sonst in Westfalen gibt. Es wird nicht berichtet, dass da viele Umbauten stattgefunden haben, obwohl es technisch möglich gewesen wäre und bis heute eigentlich ein faszinierender Gedanke ist.
Es sagte mal eine Bewohnerin ist - notiert in einem Sammelband, das Zitat packen wir dann in die Folgenbeschreibung - und eine Bewohnerin, Inge Holstein, beschrieb ihr Wohnen im Habiflex so:
Du hast ja immer diese Gaffer da gehabt. Da sitze ich an der Küchentheke auf meinem Barhocker und gucke so raus. Und auf einmal kommen fremde Leute bei mir rein. Guten Tag. Und da wollen die einen Kaffee trinken. Die haben gedacht, meine Wohnung wäre ein Café oder sowas. Die haben die offene Tür als Einladung aufgefasst. Auf Außenstehende hat das Haus zum Teil komisch gewirkt.
Greta Civis: Also ich denke, die Dame hat im Erdgeschoss gewohnt. Und es war einfach gesellschaftlich nicht verankert, dass Leute so halb im offenen Raum sitzen und da Kaffee trinken. Dann ist gleich die Idee, man kann da mitmachen.
Thomas Spohn: Wichtig ist ja erstmal, dass überhaupt Leute kommen. Das ist damals ein bundesweit diskutiertes Projekt gewesen. Es ist durch alle Architekturzeitschriften, durch alle Blätter, also auch die Zeitungen, Tageszeitungen gegangen. Das war die Illustrierten, der Stern, alle haben berichtet, die Bunte hat berichtet. Deshalb sind Menschen überhaupt nach Barkenberg gegangen und haben sich diesen Habiflex angeguckt, von dem sie so fabelhafte Dinge gehört haben.
Es war in der Fachwelt, war das damals - ich habe zu dieser damaligen Zeit Architektur studiert - war klar, man muss da eine Omnibus-Exkursion machen von Hamburg nach Wulfen, damit man den Habiflex und die Metastadt und die anderen Wohnbauprojekte, die es gibt, die nicht sehr viel unauffälliger sind, sondern genauso bemerkenswerte Beispiele von damaliger Architektur sind, um die sich anzugucken.
Greta Civis: Dann gab es so ein bisschen von planerischer Seite auch die Idee, die Leute sind einfach noch nicht so weit. Wir haben schon die richtigen Pläne, aber die Menschen sind noch nicht so weit. An denen müsste es jetzt liegen, das besser anzunehmen, was da ist.
Thomas Spohn: Ja, das ist aber eine grundsätzliche Frage zwischen Architekt und Bauherrschaft beziehungsweise Bewohnerschaft. Macht der Architekt nur das, was irgendeiner schon weiß, was er haben will, oder macht er einen Vorschlag, wie es vielleicht besser sein könnte? Und wenn man ein urbanistisches Projekt macht, was weit beachtet ist und was womöglich Schule machen sollte, dann wird man selbstverständlich Vorschläge machen, wie man es sich vorstellt, wie es aussehen müsste.
Und wir sagen ja, wir probieren es, wir werden schon die Leute überzeugen, wenn es denn mal fertig ist und sie es sich anschauen können und etwas probieren können.
Jede Fertighausausstellung macht genau dasselbe. Die stellen da Fertighäuser hin und hoffen, dass einer die kauft. Es ist vielleicht etwas übertrieben gewesen, die Erwartungen der Architekten, dass es funktioniert. Man hat es als selbstverständlich betrachtet, dass es angenommen würde. Und tatsächlich haben die Leute auch gar nichts dagegen, in solchen Häusern zu wohnen. Sie ändert es nur nicht. Und wenn man, auch das ist beim Habiflex so, auch bei den vergleichbaren Bauten, zu einer versetzbaren Wand muss selbstverständlich ein System gehören, das sie irgendwo hält. In dieser Wand sind oder auf dieser Wand sind Elektroleitungen. Es ist die Frage, wo laufen die Heizungsrohre? Und all das muss geplant werden, sodass es versetzbar ist. Das ist sehr teuer. Wenn aber keiner versetzt, fragt man sich schon, wofür man diese Investition denn eigentlich getätigt hat. Diese vorausschauende Planung für alle möglichen Varianten.
Greta Civis: Dinge ausprobieren ist wichtig, auch in Kauf zu nehmen, dass sie dann nicht angenommen werden. Wenn Sie sagen, in Ihrem Studium war es eigentlich klar, man muss da mal hinfahren und sich das angucken, sollten das heutige Studierende der Architektur immer noch tun? Da mal hinfahren und sich das angucken, wie es jetzt ist, nach den Versuchen?
Thomas Spohn: Ja, sowieso. Der Habiflex ist ein bedeutendes Beispiel der Architekturdiskussion der 1960er und 70er Jahre. Und er ist auch nicht aus der Zeit gefallen, Und er ist auch nicht aus der Zeit gefallen, sondern die Frage, wie man wohnen will, ist ja bis heute überhaupt nicht weniger, sondern eher noch brisanter. Wenn Einfamilienhaushalte auf 130 Quadratmeter wohnen, denkt man schon, es könnte ja eine Möglichkeit geben, diese Wohnfläche zu verkleinern, sodass mehr Leute wohnen können. Das ist das eine.
Das zweite ist, dass sowohl die Metastadt als auch der Habiflex, als auch einige andere Projekte in der neuen Stadt Wulfen auf Vorfertigung gesetzt haben. Das war die zweite große Versprechung der damaligen Architektur, dass mit Vorfertigung Baukostenersparnis in einem Umfang erzielt werden können, dass man die Wohnungsnot beseitigt. Das ist eine Überlegung, die bis heute notwendig ist. Denn wenn gesagt wird, wir brauchen 400.000 Wohnungen pro Jahr, wie sollen die denn entstehen außer vorgefertigt angesichts der heutigen steigenden Baupreise? Von daher die Frage der Vorfertigung ist brisant bis heute oder wieder.
Greta Civis: Und das Konzept des vorgefertigten Bauens ist auch nicht gescheitert, oder?
Thomas Spohn: Im öffentlichen Diskurs ja. Man braucht nur von der Platte zu reden, dann lachen alle und denken an Hoyerswerda. Dass diese Platte in der Bundesrepublik genauso gebaut worden ist, in genauso großen Stückzahlen, vielleicht nicht mit Waschbeton, das wird dabei vergessen. Und dass da unglaublich Zehntausende Menschen in Plattenbauten, das heißt vorgefertigte Wandtafelbauten, um es genau zu sagen, wohnen, wird übersehen. Die Platte ist nicht gescheitert, keinesfalls. Es ist nur, sie ist in Verruf gekommen. Und man hat eine Zeit lang gedacht, man kommt ohne aus. Man kann konventionell die Wohnungsnot oder den Wohnungsmangel beheben.
Greta Spohn: Und die neue Stadt, die Raumstadt, die gemischte Stadt, die alles vorhält, was man hat, außerdem luftig ist, grün, dieses Konzept, ist das gescheitert in Wulfen? Oder ist man da bescheidener geworden, weil Sie auch von der Hybris der Planer sprachen?
Thomas Spohn: Das Experiment dieser Metastadt ist gescheitert. Sie ist einfach weg. Es ist auch leider so, dass vergleichbare Bauten, etwas andere Systeme, aber mit demselben Konzept, Primärstruktur als Tragstruktur, Sekundärstruktur mit verschiedenen Funktionsmöglichkeiten, das ist international im Abbruch begriffen, zum Beispiel auch in Japan. Es scheint sich nicht zu realisieren.
Greta Civis: Sie haben schon ganz wunderbar übergeleitet zu einem anderen Punkt. Sie haben beide in den Vorgesprächen abgelehnt, darüber zu reden, ob es eine westfälische Art des Scheiterns gibt. Das respektiere ich. Aber lassen Sie mich die Frage nochmal ein bisschen anders versuchen. Wird andernorts anders gescheitert oder läuft Scheitern immer gleich?
Thomas Küster: Also ich glaube, dass es keine westfälische Variante des Scheiterns gibt. Aber wie wir es eben schon mal kurz besprochen haben, eine regionale besondere Form des Scheiterns gibt es schon. Aufgrund der Umstände und Bedingungen, die in jeder Region etwas anders vorhanden sind. die in jeder Region etwas anders vorhanden sind. Also es hängt von den jeweiligen Akteuren vor Ort ab, es hängt davon ab, was für Milieus sich in bestimmten Teilregionen befinden, wie die reagieren auf bestimmte Projekte. Also eine westfälische Form des Scheiterns sehe ich nicht, aber regionale Besonderheiten und eigene Entwicklungen gibt es schon immer.
Thomas Spohn: Es hat einmal eine Zeit gegeben, wo Neuerungen abgewehrt wurden mit dem Argument, das sei nicht westfälisch. Diese Zeit ist Gott sei Dank vorbei. Das habe ich in letzter Zeit nicht mehr gehört oder hört man seltener. Ich wollte verweisen eigentlich darauf, dass wenn man über Scheitern redet und verschiedene Bereiche des Scheiterns sich anschaut, dass es sinnhaft ist, es zu strukturieren, welches denn die Rahmenbedingungen gewesen sind des einzelnen Objektes.
Also Herr Küster schreibt in der Einführung dieses Bandes auf Seite 7, in Rückgriff auf einen anderen Autor, systematisiert er zu starke Konkurrenz erstens, zweitens technische organisatorische Probleme, drittens Fehleinschätzungen hinsichtlich der Nutzung bzw. zu geringe Unterstützung bei der Realisierung, viertens Kommunikationsprobleme und hohe Anpassungserfordernisse, fünftens ein instabiles Gesamtumfeld und sechstens ein ungünstiger Zeitpunkt für die Umsetzung der geplanten Projekte.
Greta Civis: Das ist von Reinhold Bauer, ne?
Thomas Spohn: Das, denke ich, ist eine Zugriffsmöglichkeit, wo man die verschiedenen Beiträge dieses Bandes ganz gut in ein Schema kriegt, dass man sie vergleichen kann. Und sie sagt gleichzeitig, was Westfälisches ist darin nicht.
Greta Civis: Die Bauprojekte, die im Band erscheinen und auch Bauprojekte, die in der Presse sind, die scheitern ja häufig spektakulär, allein schon wegen der Kosten. Da nimmt die Öffentlichkeit einen großen Anteil dran. Das ist außerdem sichtbar. Es geht dabei dann häufig um Scheitern im Bau oder nach dem Bau. Also es gibt tatsächlich auch schon eine physische Präsenz des Ganzen. Gibt es typische Probleme, wie Bauprojekte scheitern oder typische Faktoren, an denen Bauprojekte scheitern?
Thomas Küster: Also es sollte jetzt nicht der Eindruck entstehen, als ob es immer nur um Bauprojekte scheitern? Bauprojekte sind deshalb so interessant und Herr Spohn hat das ja ausgeführt, weil sie groß und komplex sind, weil viele Ebenen und Akteure und Genehmigungsbehörden und Architekten und Nutzer und Mieter beteiligt sind.
Greta Civis: Und auch gesellschaftliche Ideen daran verhandelt werden.
Thomas Küster: Und gesellschaftliche Ideen, ganz genau. Und jede dieser Teilgruppen hat so eine eigene Logik. Und das prallt dann im Zuge eines Bauprojektes alles aufeinander. Und dann gibt es natürlich noch diese Projekte, also Flughäfen oder denken Sie an Stuttgart 21. Die sind so unglaublich kostenintensiv, dass so viel Input da in dieses Bauprojekt vorhanden ist, dass immer mal irgendwo was nicht zusammenpasst.
Stuttgart 21 diskutiert man sogar noch bis heute, obwohl das Ganze gesellschaftlich einigermaßen befriedet worden ist inzwischen. Aber man kann praktisch einmal im Monat lesen, dass es wieder irgendein Problem gibt. Ich glaube im Augenblick gerade mit der digitalen Technik. Und einige sagen, wir sind immer noch nicht sicher, ob das klappt. Also darum spielen Bauprojekte, wenn man das Thema Scheitern behandeln will, natürlich immer eine prominente Rolle. Aber sie sollten nicht die einzige Rolle spielen.
Was wir in dem Band ausgeklammert haben, sind sozusagen persönliche Fälle des Scheiterns. Die gibt es natürlich auch immer noch. Da kann man sich in einer biografischen Perspektive auch mal mit auseinandersetzen. Aber wir haben hier mehr versucht, diese gescheiterten Projekte als eine Sonde dafür zu nehmen, wo liegen tiefere Ursachen für solche Fälle und wie verhandeln die Menschen diese Dinge, die scheinbar nicht funktionieren und schief gehen.
Und wie wird das nachher bewertet? Mehr und mehr kommen wir ja zu dem Eindruck, dass Scheitern im Grunde ein Teil von Normalität auch ist. Also, dass jedem dieser Projekte zumindest die Option des Scheiterns auch immanent ist. Das gilt insbesondere gerade auch für alles, was so im politischen Bereich stattfindet.
Darüber haben wir eigentlich noch gar nicht gesprochen. Es ist eigentlich ein fester Bestandteil von demokratischen Prozessen. Überall dort, wo eine Abstimmung abgehalten werden muss, gibt es immer sozusagen eine Partei, die das befürwortet hat, was da zur Abstimmung steht. Und sehr oft, im Regelfall, gibt es dazu eine Partei, die das befürwortet hat, was da zur Abstimmung steht. Und sehr oft, im Regelfall, gibt es dazu eine Opposition, die das ganz anders sieht. Und wenn es dann zur Abstimmung kommt, was ein demokratischer Vorgang ist, dann hat die eine Seite eben keinen Erfolg gehabt und ist gescheitert mit ihrem Vorhaben. Es ist ganz normal.
Greta Civis: Und auch kein Argument ist dann gar nicht erst zu machen. Es ist ganz normal. Und auch kein Argument ist dann gar nicht erst zu machen.
Thomas Spohn: Zumal es ja auch Wandlungen gibt in der Beurteilung des soeben Gescheiterten. Es ist ein bisschen penetrant, aber ich komme nochmal auf die neue Stadt Wulfen zurück, die von vornherein als volle elektrische Siedlung geplant worden ist. Der Grund dafür war, dass das Bergwerk für seine Kohle über das Kraftwerk eine Abnahmegarantie haben wollte, zumal es dann auch noch billiger ist, wenn man nur Elektroleitungen baut und nicht auch noch Gasleitungen und womöglich irgendwelche Öltanks.
Etwa 1990 war die einheitliche Meinung, die neue Stadt Wulfen ist auch deshalb ein problematischer Fall, weil es diese Vollelektrifizierung gibt. Heutzutage ist es so, dass man vorschlägt, dass jedes Auto mit Elektrizität fährt. Von daher kann mittlerweile keiner eigentlich mehr was dagegen haben, dass in Wulfen weiterhin mit Nachtspeicheröfen geheizt wird. Also ein Wandel in der Wertschätzung und damit in der Beurteilung, ist etwas gescheitert oder ist etwas ein Erfolg. Das ist bei Gebäuden eben auch sehr stark der Fall, dass es eben mangelnde Wertschätzungen gibt. Und das ist nicht unbedingt immer sachlich.
Greta Civis: Und jetzt wagen wir einmal die Prognose. Wenn wir die Wahl hätten, gar nicht mehr scheitern zu müssen, würden wir das wollen?
Thomas Küster: Also erst mal ist dieser Wunsch, glaube ich, wirklich etwas irreal. Solange Menschen irgendwie handeln und agieren und Initiativen stattfinden und wir alle wollen ja irgendwie immer etwas besser machen, wird es auch ein Scheitern geben. Und davon abgesehen, darauf hat Herr Spohn gerade auch angespielt, können wir aus dem Scheitern ja auch immer was lernen. Also von daher müssen wir es gar nicht meiden. Wir können es natürlich versuchen gering zu halten oder damit besser umzugehen, aber wir lernen auch immer aus dem Scheitern.
Wir haben das auch ganz häufig in der Geschichte oder auch in unterschiedlichen Kulturen. Die USA zum Beispiel haben eine ganz andere Fehlerkultur als wir hier in Europa. Berühmte und reich gewordene Leute wie Bill Gates oder Steve Jobs sind mit ihren ersten Firmengründungen kläglich gescheitert und haben sich das dann angeschaut, woran hat es gelegen oder haben bessere Ideen danach entwickelt und sind ja nun auch wirklich äußerst erfolgreich noch geworden.
Also von daher müssen wir uns nicht so anstrengen das Scheitern zu vermeiden. Wenn es um ein Projekt geht für das wir irgendwie verantwortlich sind, können wir natürlich ein bisschen was tun. Wir können mehr Vorausschau walten lassen. Wir können besser kommunizieren mit den Leuten, die das angeht, damit die das auch besser akzeptieren und damit wir sie vielleicht mit ins Boot nehmen können. Oder wir können uns auch mehr beeilen, bis wir ein Projekt abschließen. Denn je länger ein Projekt dauert, desto mehr Störfaktoren treten immer auf und können das Ganze dann eben auch eines Tages beenden. Aber wenn wir das alles so ein bisschen mitbedenken, dann können wir sozusagen das Risiko vielleicht verringern, aber nie ganz ausschalten.
Thomas Spohn: Der Norweger Nansen fuhr los und wollte sich mit einem Schiff einfrieren lassen, um die Nordwestpassage zu erkunden. Dabei ist ihm sein Schiff vom Eiszeit drückt worden und er musste, um zu überleben mit seiner Mannschaft, ein halbes oder vielleicht waren es sogar zwei Winter, bei einer Inuit-Familie oder einem Inuit-Stamm überleben und hat dabei überhaupt erst mal gelernt, wie man in dieser Gegend überleben kann. Dass man Schlittenhunde braucht, dass man Seehundkleidung braucht. Das wusste der Mitteleuropäer und auch der Nordeuropäer eigentlich nicht. Das hat er da gelernt, ist nach Hause gefahren, hat ein neues Schiff sich bauen lassen, was diesen Druck womöglich aushalten kann. Alle haben gesagt, das geht nicht, du scheiterst erneut. Er fuhr los und hat mit seinen Hunden und seinen Seehundkleidungen, hat er die Winter überlebt, die er da verbringen musste und wurde ein weltberühmter Mann.
Thomas Küster: Ja, und diese Entdecker, die Sie ja auch gerade angesprochen haben, die bieten auch noch eine ganz andere interessante Beobachtung. Es sind ja unglaublich viele Entdecker im 19. Jahrhundert gescheitert mit ihren Versuchsfahrten, irgendwas zu erkunden oder zu entdecken, was vorher noch kein Mensch gesehen hatte oder gemacht hatte. Und die Reaktionen auf diese gescheiterten Entdeckungsfahrten, die konnten sehr unterschiedlich sein. Also man hat sich entweder lustig gemacht über diese Leute, weil man ihnen von vornherein gesagt hat, ihr schafft das ja nicht. Und man fühlte sich dann sozusagen mit dieser Prognose bestätigt, also seitens der Kritiker. Aber es hat auch eine ganz andere Reaktion gegeben, also sehr viel Solidarisierung und Mitgefühl. Also die Reaktion waren sehr unterschiedlich was mal wieder unterstreicht, wie ambivalent dieses Thema Scheitern sein kann.
Greta Civis: Und umso glänzender, wenn man dann doch Erfolg hat.
Thomas Küster: Ja, aber das sollte eben auch nicht für spätere Projekte dann zu leichtsinnig machen, weil dann hat man wieder erneut dieses Problem, vor dem auch das Bauprojekt Wulfen gestanden hat, dass man eben einfach zu hohe Erwartungen hatte und diese Erwartungen dann auch auf die späteren Nutzer übertragen hat, die das nicht alles so genau so mitvollzogen haben, wie es die Planer mal im Kopf gehabt haben.
Greta Civis: Also scheitern, man kann viel daraus lernen. Es macht gute Geschichten. Wir werden es nicht vermeiden können. Und wenn man das nächste Mal scheitert, dann sollte man zumindest das Krönchen richten, nicht vergessen. Ganz herzlichen Dank Ihnen beiden für das schöne Gespräch.
Und falls ihr jetzt Lust gekriegt habt, noch mehr zu lesen zum Scheitern aus historischer Perspektive oder zu gescheiterten Projekten in Westfalen, dann empfehle ich euch Band 74 unserer Institutszeitschrift der westfälischen Forschung mit dem Themenschwerpunkt Gescheiterte Projekte, Fehlschläge, Niederlagen und Blockaden im 19. und 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Thomas Küster und Malte Thiessen.
Regionalgeschichte auf die Ohren. Untold Stories. Westfalens verborgene Geschichten erzählen. Dieser Podcast ist eine Koproduktion des LWL Medienzentrums für Westfalen und des LWL-Instituts für westfälische Regionalgeschichte. Das Projekt wird von der LWL Kulturstiftung im Rahmen des Kulturprogramms zum Jubiläumsjahr 2025, 1250 Jahre Westfalen, gefördert. Schirmherr des Kulturprogramms ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.